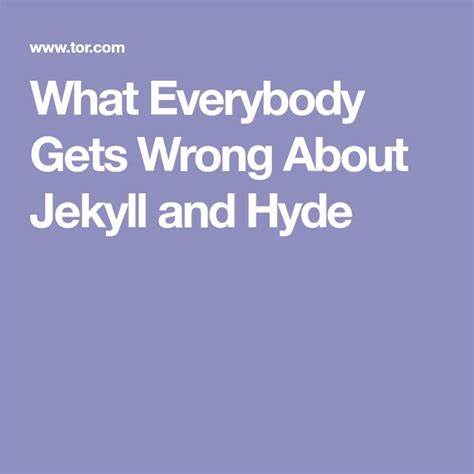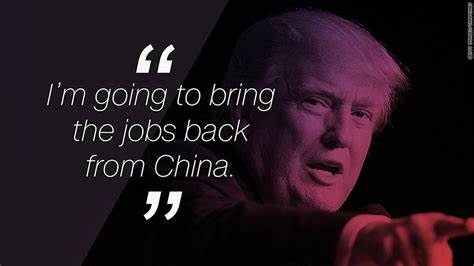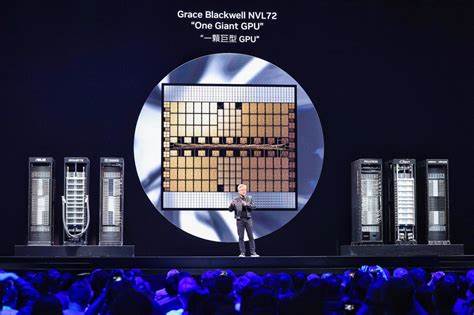Dr. Henry Jekyll und Mr. Edward Hyde gehören zweifellos zu den ikonischsten Figuren der Literaturgeschichte. Ihre Geschichte ist fest verankert in der Popkultur und wird nahezu synonym mit dem Konzept der gespaltenen Persönlichkeit oder einer Dualität aus Gut und Böse verwendet. Doch trotz der großen Bekanntheit des Themas verstehen viele Menschen die wahre Natur dieser Figuren nur unzureichend oder sogar falsch.
Robert Louis Stevensons Originalgeschichte „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ ist weit komplizierter, nuancierter und tiefgründiger, als die üblichen oberflächlichen Darstellungen vermuten lassen. Es lohnt sich daher, die Geschichte neu zu betrachten und zu verstehen, was Stevenson wirklich sagen wollte. Ein zentraler Irrtum, der sich durch nahezu alle modernen Adaptionen und Interpretationen zieht, ist die Vorstellung, dass Edward Hyde eine eigenständige, separate Persönlichkeit wäre, die in Konflikt mit Dr.
Jekyll steht. In Wirklichkeit handelt es sich bei Hyde nicht um einen unabhängigen inneren Dämon oder um eine zweite Person innerhalb derselben Existenz. Vielmehr ist Hyde ausschließlich Dr. Jekyll selbst – jene Seite von ihm, die seine gesellschaftlich nicht akzeptierten Impulse und Wünsche ungebremst auslebt. Die körperliche Verwandlung, die Jekyll durchlebt, wenn er zum Hyde wird, symbolisiert weniger eine Spaltung der Persönlichkeit im psychologischen Sinne als vielmehr die Abstreifung der Fassade und der Zwänge, die das soziale Leben bestimmen.
Wenn Jekyll, der angesehene Wissenschaftler und Gentleman in der viktorianischen Gesellschaft Londons, sich in Hyde verwandelt, nutzt er eine Maske. Diese Maske erlaubt ihm, jenen Trieben nachzugeben, die als unsittlich, gefährlich oder unverzeihlich galten – sei es Gewalt, unkontrollierte Sexualität oder andere ausschweifende Laster. Hyde ist daher nicht der „böse Zwilling“, der Jekyll gelegentlich übernimmt, sondern die bewusste Freisetzung von Jekylls verstecktem Selbst in einer Form, die gesellschaftlichen Normen trotzt. Die Namenswahl „Mister Hyde“ ist ebenfalls ein bewusstes Stilmittel Stevensons, das verdeutlicht, wie Jekyll seine dunkle Seite ausblenden will. „Hyde“ klingt wie „hide“, also verbergen oder verstecken, und verdeutlicht, dass diese Persona wie ein Umhang getragen wird, um wahre Identität und Handlungen vor der Öffentlichkeit zu verschleiern.
Historisch betrachtet verkörpert Dr. Jekyll die höfische, geregelte Welt der viktorianischen Moralvorstellungen, während Hyde die unkontrollierte, instinktive Untersicht repräsentiert. Das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Aspekten verweist auf ein tiefgründiges gesellschaftliches und psychologisches Thema: die Unterdrückung von Trieben und der Wunsch, zugleich soziale Akzeptanz und persönliche Freiheit zu genießen. Interessanterweise erhält man im Buch nie Hydes Sichtweise – es gibt keine getrennte, bewusste Persönlichkeit namens Hyde. Stattdessen beschreibt Jekyll alle seine Handlungen als „Ich“, unabhängig von der äußeren Gestalt.
Selbst bei seinen grausamsten Taten und den dunkelsten Momenten verweist er auf sich selbst; er übernimmt Verantwortung und Scham, trotz der Verwandlung. Dies hebt hervor, dass Hyde lediglich eine andere Manifestation von Jekyll ist, nicht mehr als ein äußeres Kleid seiner verborgenen Selbst. Die weitverbreitete Fehlinterpretation wird teilweise durch Jekylls eigenes unzuverlässiges Erzählen begünstigt. Er beschreibt Hyde oft als „anderen“, als ein Wesen, das Wünsche und Ziele verfolgt, die unabhängig von ihm sind. Doch dies ist eine Schutzstrategie: Jekyll versucht, sich von der Schuld seiner eigenen dunklen Taten zu distanzieren, indem er sie einer vermeintlich anderen Person zuschreibt.
Tatsächlich ist allerdings genau das Gegenteil der Fall: Er behält stets das Bewusstsein und die Kontrolle – die Verwandlung verleiht weder einen fremden Willen noch ein eigenständiges Bewusstsein. Viele Filme, Theaterstücke und Fernsehserien vermitteln dagegen ein Bild von einer gespaltenen Persönlichkeit, in der sich das „Gute“ und das „Böse“ in einem Kampf um die Kontrolle des Leibes befinden. Diese Darstellung ist zwar eingängig und dramatisch, greift jedoch zu kurz und verfehlt die psychologische Tiefe des Originalwerks. Die simplifizierte Sichtweise reflektiert gleichzeitig die menschliche Tendenz, das eigene dunkle Ich auszulagern und zu externalisieren – was unangenehme Wahrheiten über die eigene Seele und Verantwortung verschleiert. Die wahre Tragik von Dr.
Jekyll ist nämlich nicht, dass er von einem bösen Zwilling kontrolliert wird, sondern dass er es schafft, sich selbst von gesellschaftlicher Schuld freizusprechen, während er sich hemmungslos seinen verbotenen Wünschen hingibt. Seine größte Sünde besteht darin, dass er sich wünscht, Konsequenzen für sein Tun vermeiden zu können. Damit spiegelt die Geschichte die dunkle Facette der menschlichen Natur: Die Scheinheiligkeit der Moral, die Fähigkeit zur Doppelmoral und die Lebensrealität, dass man oftmals Dinge tut, die man innerlich kennt und ablehnt, während man gleichzeitig darauf hofft, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Zusätzlich wirft die Geschichte auch Fragen zu Identität und Selbstbewusstsein auf. Was bedeutet es, wirklich man selbst zu sein, wenn verschiedene Facetten der Persönlichkeit so stark voneinander abweichen können? Ist die Persönlichkeit ein unteilbares Ganzes oder ein Flickenteppich aus Wünschen, Bedürfnissen und gesellschaftlichen Rollen? Stevenson legt nahe, dass die Dikotomie von Gut und Böse im Menschen eine komplexe Einheit bildet, die nicht einfach zu trennen ist.
Nicht zuletzt steht „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ auch im Kontext der viktorianischen Gesellschaft, die von starken sozialen Normen und strenger Unterdrückung vieler menschlicher Instinkte geprägt war. Jekyll steht stellvertretend für den respektablen Gentleman, doch unter dieser Fassade lauern kaum akzeptierte Sehnsüchte und Aggressionen. Die Verwandlung in Hyde ist somit auch eine Kritik an einer Gesellschaft, die diese dunklen Seiten verbietet und gleichzeitig hervorruft.
Die Geschichte stellt sich damit als tiefgreifende Auseinandersetzung mit Heuchelei, Repression und moralischer Komplexität dar. Im modernen Kontext ist die Geschichte von Jekyll und Hyde vielfach als Metapher für innere Konflikte, Suchtverhalten, psychische Erkrankungen oder den Wunsch nach Flucht aus gesellschaftlichen Zwängen interpretiert worden. Das Bild von Hyde als „anderer“ sticht dabei als Symbol für das Verdrängte hervor, für die Seiten, die wir verstecken oder verleugnen. Dennoch ist es wichtig, die Ursache dieser Verdrängung zu verstehen: Es ist nicht eine fremde Macht, die uns kontrolliert, sondern wir selbst, mit all unseren Widersprüchen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das populäre Bild von Jekyll und Hyde als zwei voneinander getrennte Persönlichkeiten eine Vereinfachung ist, die der ursprünglichen Geschichte nicht gerecht wird.
Wirklich faszinierend ist die Erkenntnis, dass Jekyll und Hyde zwei Seiten derselben Medaille sind, zwei Fassaden eines Mannes, der mit seinen Trieben, Ängsten und der Gesellschaft ringt. Es geht dabei weniger um einen Kampf zwischen Gut und Böse als vielmehr um die oft ambivalente, widersprüchliche Natur des Menschen, der gesellschaftliche Erwartungen mit eigenen Bedürfnissen in Einklang bringen muss – oder daran scheitert. Die Gesellschaft entdeckt bei der Beschäftigung mit dieser Geschichte nicht nur das Phänomen der gespaltenen Persönlichkeit, sondern auch die Frage nach Verantwortung, Selbsttäuschung und moralischer Integrität. Gerade in unserer modernen Zeit, in der Identität und Selbstführung zunehmend thematisiert werden, gewinnt der ursprüngliche Text von Stevenson nicht an Aktualität oder Relevanz verloren. Er fordert dazu auf, sich selbst ehrlich zu betrachten, sich dem Schatten zu stellen und anzuerkennen, dass die Dinge selten schlicht in Schwarz und Weiß geteilt sind.
Diese differenzierte Sichtweise macht „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ zu einem zeitlosen Werk. Wer also Dr. Jekyll und Mr.
Hyde wirklich verstehen möchte, muss bereit sein, das eingängige Bild des Kampfes zweier Persönlichkeiten aufzugeben und stattdessen in die inneren Abgründe eines Mannes hineinzuschauen, der sich mit der eigenen Natur und ihren Folgen auseinandersetzt. Hyde ist keine fremde Macht, sondern ein Teil von Jekyll – und damit ein Teil von uns allen.