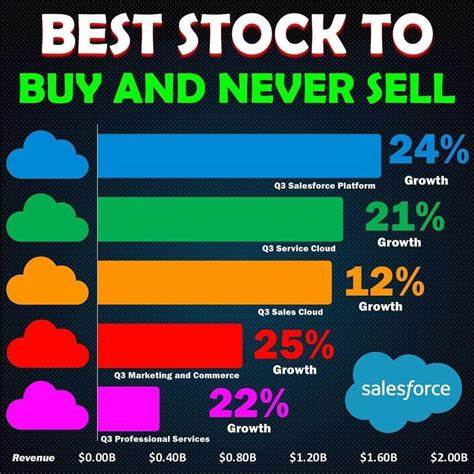Interlingua stellt eine einzigartige Form der internationalen Kommunikation dar, die vor allem auf dem gemeinsamen Wortschatz westlicher Sprachen beruht. Entwickelt zwischen 1937 und 1951 von der American International Auxiliary Language Association (IALA), ist Interlingua eine natürliche erzählte Plansprache, deren Grammatik und Vokabular stark an die romanischen Sprachen sowie an Englisch angelehnt sind. Sie wurde konzipiert, um die Hürden beim Erlernen einer neuen Sprache zu minimieren und gleichzeitig bei einem großen Publikum Verständlichkeit zu gewährleisten. Auch wenn sie heute nur von wenigen hundert Menschen tatsächlich gesprochen wird, bietet Interlingua eine faszinierende Alternative zu anderen internationalen Hilfssprachen wie Esperanto oder Ido. Die Grundlage von Interlingua bildet ein sorgfältig ausgewähltes Vokabular, das aus den sogenannten Primärkontrollsprachen stammt – Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.
Diese Sprachen teilen viele lateinische Wurzeln, wodurch Interlingua besonders für Sprecher dieser Sprachfamilien leicht verständlich ist. Interessanterweise werden Spanisch und Portugiesisch als eine Einheit behandelt, was die Auswahl der gemeinsamen Vokabeln vereinfacht. Zusätzlich gelten Deutsch und Russisch als sekundäre Kontrollsprachen, die Einfluss auf den Wortschatz nehmen können. Das Ziel ist es, Wörter zu wählen, die in möglichst vielen dieser Sprachen ähnlich oder identisch sind, und so eine Form zu schaffen, die als Prototyp für die internationale Verständigung dient. Das Prinzip hinter der Wortauswahl beruht auf der internationalen Verbreitung eines Wortes.
Selbst Begriffe mit nicht-europäischem Ursprung können in Interlingua aufgenommen werden, sofern sie in den europäischen Sprachen gebräuchlich sind. So finden sich etwa japanische Wörter wie "geisha" und "samurai" oder das finnische Wort "sauna" im Interlingua-Wortschatz wieder. Auch umgangssprachliche Begriffe wie "kanguru" (Känguru) entstammen dieser Herangehensweise. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass Interlingua durchaus kulturell reichen Wortschatz besitzt, der über eine enge Sprachgruppe hinausreicht. Im Gegensatz zu sehr konstruierten oder systematischen Sprachen, die oft komplexe grammatikalische Strukturen aufweisen, zeichnet sich Interlingua durch eine vergleichsweise einfache, regelmäßige Grammatik aus.
Sie verzichtet auf komplizierte Beugungen, Fälle oder grammatikalische Geschlechter und lehnt sich damit stark an die vereinfachte Struktur des Englischen an. Singular und Plural werden durch einfache Endungen gebildet, und die Wortstellung folgt meist der klassischen Subjekt-Verb-Objekt-Struktur. Die Verben werden in wenigen Formen verwendet und weisen keine ausgedehnten Konjugationen auf. Das macht Interlingua gerade für Lernende aus verschiedenen Sprachräumen zugänglich und leicht erlernbar. Der Ursprung von Interlingua lässt sich auf die Initiative der amerikanischen Philanthropin Alice Vanderbilt Morris zurückführen, die in den 1920er Jahren die International Auxiliary Language Association gründete, um die Suche nach einer optimalen internationalen Hilfssprache wissenschaftlich zu unterstützen.
Anfangs wollte die Organisation bestehende Plan- oder Kunstsprachen vergleichen und möglicherweise eine der etablierten Sprachen fördern. Doch nach intensiver Forschung wurde klar, dass keine der bereits existierenden Konstruktionen den Anforderungen genügte. So entschied man sich, eine neue Sprache zu entwickeln, die das Beste aus verschiedenen natürlichen Sprachen kombiniert und zugleich eine vereinfachte Struktur besitzt. Die Entwicklung von Interlingua verlief in mehreren Phasen, in denen verschiedene Modelle geprüft, mit Sprachprofis abgestimmt und schließlich zu einem Kompromiss zusammengesetzt wurden. Während des Zweiten Weltkriegs kam es zu Verzögerungen, aber auch zu wichtigen Erkenntnissen: Die naturalistische Ausrichtung, die sich am natürlichen Sprachgebrauch und historischen Wurzeln orientiert, wurde gegenüber stärker schematischen und künstlichen Modellen favorisiert.
Alexander Gode, der maßgeblich an der letzten Ausarbeitung beteiligt war, schaffte es, die Sprache sowohl nahe an den romanischen Sprachen zu halten als auch dabei eine internationale Verständlichkeit sicherzustellen. Die Veröffentlichung der Interlingua-Grammatik und des Interlingua-Englisch-Wörterbuchs im Jahr 1951 markierte die offizielle Vorstellung dieser Sprache. Interlingua fand in den folgenden Jahrzehnten vor allem in der Wissenschaft Verwendung. Ab den 1950er Jahren erschienen Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften, die Zusammenfassungen teilweise auch in Interlingua anboten, besonders in medizinischen und naturwissenschaftlichen Fachgebieten. Auf diese Weise konnte eine internationale Verständigung jenseits der Sprachgrenzen gewährleistet werden und wissenschaftliche Ergebnisse einer größeren Leserschaft zugänglich gemacht werden.
Die Bemühungen, Interlingua als internationale Sprache zu fördern, wurden durch verschiedene Organisationen wie die Union Mundial pro Interlingua (UMI) und lokale Gesellschaften unterstützt. Trotz des Erfolgs in wissenschaftlichen Kreisen konnte sich Interlingua als allgemein gebräuchliche Welthilfssprache nicht gegen Englisch durchsetzen, das im globalen Kontext als Lingua franca eine dominante Rolle einnimmt. Dennoch hat die Verbreitung des Internets eine Wiederbelebung des Interesses an konstruierten Sprachen ermöglicht. Interessierte aus aller Welt können heute problemlos Materialien zur Selbstlernung finden und sich mit anderen Sprechern vernetzen. Periodika wie das „Panorama in Interlingua“ stellen eine Plattform für Nachrichten, Wissenschaft und kulturelle Themen in Interlingua bereit.
Zudem werden alle zwei Jahre internationale Konferenzen abgehalten, unter anderem in Skandinavien, wo traditionell ein größerer Kreis von Interlinguasprechern anzutreffen ist. Die Verwendung von Interlingua in Schulen und Universitäten ist gelegentlich als pädagogisches Hilfsmittel zur Vermittlung von Sprachstrukturen und internationalem Wortschatz etabliert. Seine klar strukturierte und übersichtliche Grammatik macht es zu einem nützlichen Werkzeug, um die Gemeinsamkeiten zwischen romanischen Sprachen zu verdeutlichen oder interlinguistische Fragen zu erforschen. Ein Beispiel hierfür ist ein Kurs an der Universität Granada im Jahr 2007, der Interessierten einen Einstieg in die Sprache in kurzer Zeit ermöglichte. Die Orthographie von Interlingua folgt dem lateinischen Alphabet ohne diakritische Zeichen, was die Schreibweise für die Lernenden erleichtert.
Die Buchstaben entsprechen meist der Aussprache in den romanischen Sprachen, wobei einige Laute flexibel gehandhabt werden können, um regionale Varietäten und Sprecherpräferenzen zu berücksichtigen. Die Aussprache nähert sich dabei einer phonetischen Transparenz an, wie sie auch in Sprachen wie Spanisch oder Italienisch anzutreffen ist. In der Praxis ist Interlingua jedoch primär eine geschriebene Sprache, was auch die vielfältigen Einsatzbereiche in Publikationen und digitalen Medien unterstreicht. Die systematische Auswahl des Vokabulars und die Einfachheit der Grammatik machen Interlingua zu einer der verständlichsten konzipierten Sprachen überhaupt für Sprecher europäischer Sprachen. Ihre Konstruktion erlaubt es, viele Wörter durch eine Kombination von Wortstämmen und bekannten Affixen zu bilden, was den Wortschatz flexibel und lebendig macht.
Gleichzeitig verhindert die Sprache jedoch zu komplexe oder unnütze Wortbildungen, um den Fokus auf Klarheit und Nützlichkeit zu bewahren. Die Rezeption von Interlingua ist nicht frei von Kritik. Einige Experten weisen darauf hin, dass natürliche Sprachen wie Englisch oft einfach zugänglicher sind als eine künstlich konstruierte Sprache, selbst wenn diese auf Einfachheit ausgelegt ist. Dennoch schätzen Befürworter die Vorteile einer einheitlichen Hilfssprache, die keine kulturellen oder nationalen Eigenheiten bevorzugt und speziell für den internationalen Gebrauch optimiert wurde. Interlingua eröffnet zudem Einblicke in die Verwandtschaft europäischer Sprachen und fördert ein besseres Verständnis der sprachlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Visuell erkennt man Interlingua gelegentlich an speziellen Symbolen. So wurde beispielsweise eine Flagge mit einem vierzackigen weißen Stern auf blau-rotem Hintergrund vorgeschlagen, die die Verbindung zwischen den verschiedenen Sprachgruppen und die globale Verständigung symbolisiert. Auch ein Sternbild mit zwölf Sternen, das an die Europaflagge erinnert, wird als Emblem verwendet. Letztendlich steht Interlingua als faszinierendes linguistisches Experiment und als lebendige Kommunikationsmöglichkeit, die sich durch ihre Nähe zu natürlichen Sprachen und ihre klare Struktur auszeichnet. Sie bietet eine Brücke zwischen Kulturen und Sprachgemeinschaften, die auf dem Fundament eines gemeinsamen Wortschatzes und einer einheitlichen Grammatik beruht und gleichzeitig die historischen und kulturellen Verbindungen Europas widerspiegelt.
Für Sprachinteressierte, Linguisten und Freunde internationaler Kommunikation bleibt Interlingua ein bedeutsames Werkzeug und gesellschaftliches Projekt, das trotz seiner überschaubaren Sprecherschaft weitreichende kulturelle und wissenschaftliche Impulse vermittelt.
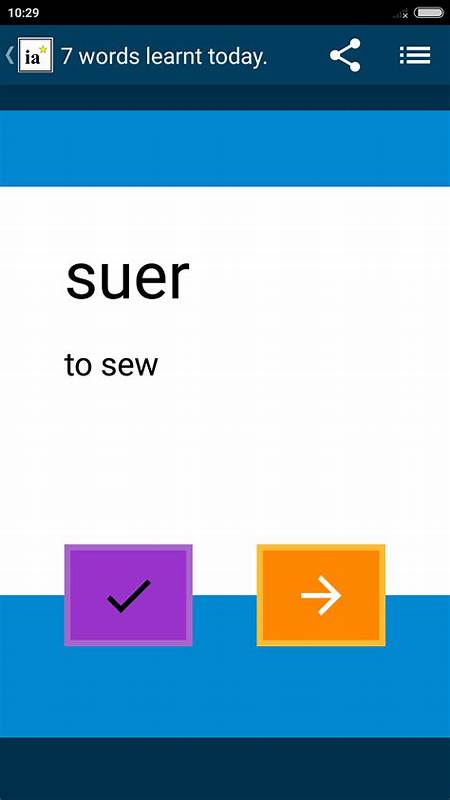



![Formalizing a Proof in Lean Using GitHub Copilot Only – Terence Tao [video]](/images/6B2708AD-5192-46A5-A590-FAF8602E2A55)