In einer Zeit, in der Begriffe wie Künstliche Intelligenz (KI) mit mystischer Aura umgeben werden und technologische Neuerungen mit hohen Erwartungen gefeiert werden, ist es wichtiger denn je, einen klaren Blick auf das zu haben, was tatsächlich vor sich geht. Die Kunst des Verstehens, was wirklich passiert, verlangt mehr als nur die Annahme von Schlagworten und oberflächlichen Erklärungen. Sie erfordert das genaue Erkunden der Mechanismen, die hinter Systemen, Unternehmen und Märkten arbeiten, um nicht von Illusionen getäuscht zu werden. Wer es versteht, dieser komplexen Wirklichkeit auf den Grund zu gehen, verschafft sich einen nachhaltigen Vorteil und kann in Zeiten von Umbruch und Wandel bestehen. Die heutige Wirtschaft und Technologie sind geprägt von einer Flut an Versprechungen.
Investoren und Gründer setzen auf „AI“ als Zauberwort, das scheinbar alle Probleme löst und Unternehmen zum Höhenflug verhilft. Doch bei genauer Betrachtung offenbart sich, dass die meisten Geschäftsmodelle trotz schön klingender KI-Narrative im Kern auf traditionellen Wertschöpfungsmechanismen beruhen. Diese Erkenntnis führt uns zu den zentralen Prinzipien, die als Systemantics bekannt sind – die Disziplin, verborgene Systemmechanismen zu erkennen und die wahre Natur dessen zu verstehen, was geschieht. Eines der grundlegenden Axiome besagt, dass der Name oft nicht das ist, was das System tatsächlich ausmacht. Labels und Marketingbegriffe prägen Vorstellungen, die oft von der Realität abweichen.
Ein „Restaurant“ suggeriert kulinarische Erlebnisse, doch häufig sind es Getränke und alkoholische Umsätze, die die eigentlichen Margen sichern. Ein Dienstleistungsunternehmen, das sich als KI-getrieben darstellt, nutzt häufig mehrheitlich bewährte Methoden des Talentmanagements, der Kapitalbeschaffung und Integrationsfähigkeit, um am Markt zu bestehen. Damit ist der Name nicht selten ein Schleier, der von den wahren Einnahmequellen ablenkt. Ein weiteres wesentliches Prinzip zeigt, dass Menschen innerhalb von Systemen selten nach den offiziellen Vorgaben handeln. Hochschulprofessoren bemühen sich beispielsweise oft um Drittmittel und weniger um reine Lehre, Venture Capitalists pflegen ihre persönliche Marke neben der Finanzierung von Startups, und Gründer optimieren oftmals Kennzahlen, die Investoren gefallen, anstatt unmittelbar auf Kundenbedürfnisse einzugehen.
Die Aktivitäten und Motivationen weichen also häufig von den eigentlichen Systemzielen ab, was zu Verzerrungen in der Wahrnehmung und Bewertung führt. Darüber hinaus tut das System selbst nicht unbedingt das, was es nach außen suggeriert. Die Druckindustrie verdient beispielsweise weniger mit Druckern als viel mehr am Absatz von Tinte. Digitale Plattformen wie Lebensmittellieferdienste funktionieren zwar auf den ersten Blick als Vermittler, erzielen ihre wichtigsten Profitquellen jedoch über Werbenetzwerke und Kundendatenanalyse. Erfolgreiche Unternehmen schaffen es, sich ein Geschäftsfeld aufzubauen, das weniger mit der offensichtlichen Leistung als mit subtileren Einnahmestellen zu tun hat.
Dieses Verständnis hilft, das Narrativ zu durchschauen und die wirtschaftlichen Realitäten hinter dem Hype sichtbar zu machen. Ein Blick auf bekannte Unternehmen verdeutlicht dies. Nordstrom wird als Luxusmodehaus wahrgenommen, doch der eigentliche Gewinn entsteht zu großen Teilen durch Co-Branding-Kreditkarten, die hohe Margen abwerfen, während die Marge bei Bekleidung eher marginal bleibt. Die Aktienhandelsplattform Robinhood lockt Nutzer mit kostenlosen Trades, verdient ihr Geld jedoch durch den Verkauf von Orderflow an hochfrequente Händler. Diese Differenz zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit prägt viele Geschäftsmodelle vor allem in hochdynamischen Technologiefeldern.
Die Herausforderung besteht darin, die Lücken zwischen den offiziellen Erklärungen und den tatsächlichen wirtschaftlichen Anreizen zu identifizieren. Dies verlangt genaue Analyse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das Erkennen der wahren Profitquellen und die Beobachtung, wofür Menschen tatsächlich Zeit und Ressourcen aufwenden. In Märkten, in denen KI immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist es für Gründer und Investoren entscheidend, nicht nur den oberflächlichen Glanz zu verfolgen, sondern die nachhaltigen ökonomischen Grundlagen zu verstehen. Ein im Silicon Valley verbreiteter Mechanismus ist die sogenannte „Request for Startups“, bei der bestimmte Probleme vorgegeben werden, die gelöst werden sollen. Die systemische Erkenntnis zeigt, dass dies oft den Ideenraum einschränkt und innovative Durchbrüche verhindert, weil Lösungen immer in vordefinierten Rahmen gesucht werden.
Revolutionäre Unternehmen entstehen selten durch die Beantwortung vorgegebener Problemstellungen, sondern durch das Erkennen neuer, bisher übersehener Möglichkeiten. Facebook und Google sind prominente Beispiele für Gründer, die durch ihren individuellen Blick ganz neue Wege geeint haben. Ihre Erfolge unterstreichen, dass Kreativität und ein unabhängiges Verständnis von Systemen der Schlüssel zu echten Innovationen sein können. Die Rolle von Systemantics ist es, weitaus tiefer zu fragen: Was optimiert dieses System wirklich? Was sind die verborgenen Ziele und wie unterscheiden sie sich von der öffentlichen Selbstdarstellung? Das Studium dieser Fragen eröffnet strategische Einsichten und hilft, jene wirtschaftlichen Muster zu erkennen, die immer wieder auftreten, unabhängig von wechselnden Technologien und Trends. Die Fähigkeit, diese Muster schnell zu durchschauen, garantiert in einer unübersichtlichen Welt der Informationsflut einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Nicht zuletzt zeigt das Beispiel großer Cloud-Anbieter, wie selbst KI-Dienste oft vor allem als Mittel zur Kundenbindung und Ökosystemerweiterung dienen. Amazon, Microsoft und andere machen KI zu einem integralen Teil ihrer Plattformstrategien, die langfristig vor allem ihr dominantes Marktpositionen festigen. Die technischen Innovationen sind real, jedoch sind die Geschäftsmodelle vielschichtiger und folgen bewährten Grundprinzipien der Wertschöpfung und Kundengewinnung. Dies zu verstehen, bewahrt davor, in unrealistische Bewertungen oder Erwartungen zu verfallen. Nicht alle Systeme und Technologien verbergen ihre wahre Funktion.
Einige KI-Anwendungen, wie etwa automatisierte Codierung, generative Medien oder Modelle zur Qualitätskontrolle, liefern tatsächlich spürbare Produktivitätsgewinne und lösen klar definierte Probleme. Entscheidend ist, diese realen Fortschritte von den oft übertriebenen Hypes zu unterscheiden, die als Marketinginstrumente fungieren. Nur so können Investitionen und Unternehmensstrategien auf eine solide Grundlage gestellt werden. In der Summe geht es bei der Kunst des Verstehens darum, den Abstand zwischen dem, was Systeme versprechen, und dem, was sie tatsächlich leisten, zu erkennen. Es gilt, geduldig die verborgenen Mechanismen zu entschlüsseln und damit den flüchtigen Illusionen zu trotzen, die in Phasen technologischen Umbruchs besonders stark auftreten.
Diejenigen, die es schaffen, diese Tiefenstruktur zu durchschauen, werden als Gewinner aus der Veränderung hervorgehen. Für die Zukunft zeichnen sich zwei wesentliche Pfade für erfolgreiche KI-Unternehmen ab: Einerseits der Ausbau unauffälliger, aber unverzichtbarer Werkzeuge, die nachweisbar Margen verbessern oder Kosten senken. Andererseits die Förderung echter Forschungsfelder, die bisher unbekannte Problemräume erschließen und technologisch neue Horizonte eröffnen. Das Erkennen und Besetzen dieser Zwischenräume zwischen selbstbewusster Ambition und operativer Realität wird den langfristigen Erfolg bestimmen. Das Verstehen dessen, was wirklich geschieht, ist keine einfache Aufgabe.
Es erfordert eine Bereitschaft, oberflächliche Narrative hinter sich zu lassen, kritisch zu hinterfragen und tiefer zu graben. Genau darin liegt die wahre Kunst – und die Schlüsselkompetenz unserer Zeit, um nicht nur zu überleben, sondern aktiv die Zukunft zu gestalten.
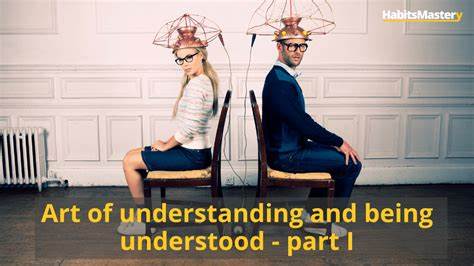



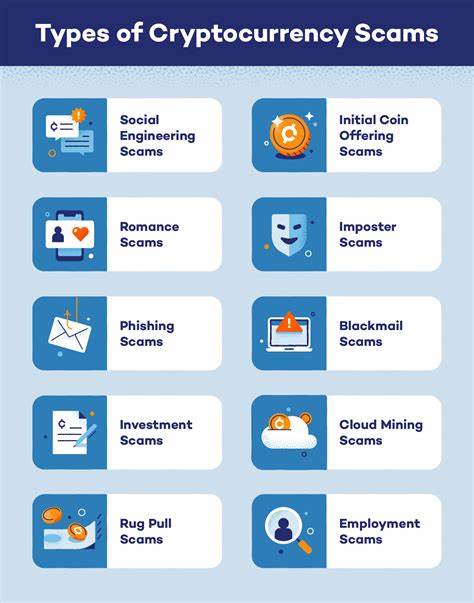
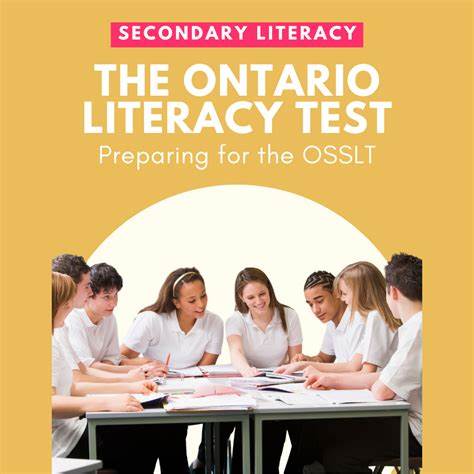

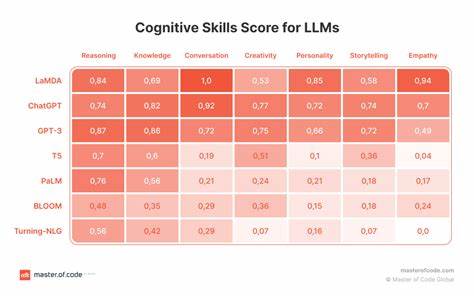

![Life after a tech layoff: five months update –- it's jepi [video]](/images/9C0B544D-64E9-4050-BC64-F61F3A87003A)