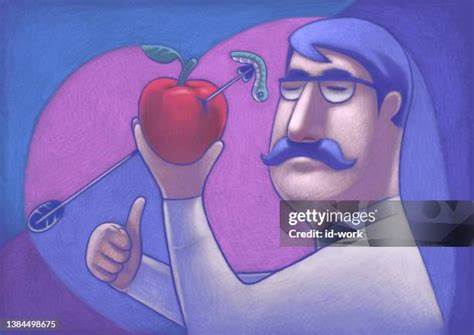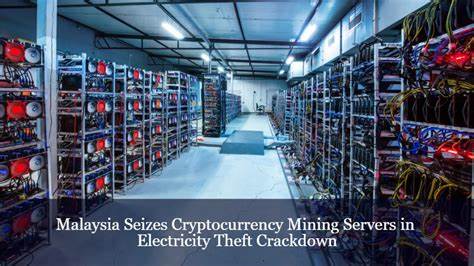Silicon Valley wird oft als das Epizentrum brillanter Gründerpersönlichkeiten gefeiert, die in Garagen bahnbrechende Technologien geschaffen und damit den Lauf der Welt verändert haben. Die gängige Erzählung besagt, dass visionäre Unternehmer wie Steve Jobs, Bill Gates oder Mark Zuckerberg allein durch Risikobereitschaft und Genialität Innovationen hervorbrachten, die mit minimaler staatlicher Einmischung entfaltet wurden. Dieser Mythos formt nicht nur das Selbstverständnis der Technologiekonzerne, sondern prägt auch politische Entscheidungen hinsichtlich Regulierung und staatlicher Förderung. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein wesentlich komplexeres Bild: Die Entstehung und das Wachstum von Silicon Valley sind ohne die maßgebliche Rolle des Staates kaum vorstellbar. Die Geschichte widerlegt die Vorstellung, dass technologische Fortschritte primär das Ergebnis von unregulierten Märkten und privatem Unternehmertum sind.
Tatsächlich fußt das Silicon Valley auf einer jahrzehntelangen, gezielten staatlichen Förderung, die auf Forschung, Entwicklung und Marktgestaltung abzielte und den Boden für private Investitionen und unternehmerische Innovationskraft erst bereitete. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand in der Region rund um Stanford noch kaum eine Technologiebranche. Die wenigen Pioniere wie David Packard und William Hewlett arbeiteten vorwiegend als Auftragnehmer für das Militär. Die Gründung der Hewlett-Packard Company etwa erfolgte nach der Auszeichnung durch das Militär für herausragende Kriegsproduktion – ein Zeichen für die enge Verbindung zwischen militärischer Förderung und technologischem Fortschritt. Die Nachkriegszeit und vor allem der beginnende Kalte Krieg mit der Sowjetunion intensivierten die staatliche Einmischung – speziell das Verteidigungsministerium wurde zum Hauptakteur bei der Förderung von Spitzentechnologien.
Eine der zentralen Einrichtungen dieser Ära war die 1958 gegründete Advanced Research Projects Agency (ARPA), die später als DARPA bekannt wurde. Sie war speziell dafür geschaffen worden, Grundlagenforschung mit langfristiger Perspektive voranzutreiben, die nicht unmittelbar durch den Markt getrieben oder von Unternehmen finanziert werden konnte. Durch ein dezentrales Netzwerk von Experten, die zwischen Universitäten, Forschungslabors und Unternehmen agierten, koordinierte sie Projekte, die später unter anderem die Grundlage für Personal Computer, grafische Benutzeroberflächen und das Internet bildeten. Viele der heute als selbstverständlich geltenden Technologien wie die Computermaus oder die Netzwerkprotokolle sind direkte Produkte oder Ableitungen von ARPA-geförderter Forschung. Neben der Förderung von Grundlagenforschung übernahm der Staat auch die Rolle eines frühen Kunden.
Militär- und Raumfahrtprogramme erzeugten eine Nachfrage nach neuartigen Technologien und ermöglichten damit die Skalierung von Produktion und Technologieentwicklung. Die Transistoren und später integrierten Schaltkreise, die für moderne Computer unverzichtbar sind, wurden durch staatliche Aufträge zunächst überhaupt wirtschaftlich nutzbar. Wichtige Innovationen, beispielsweise in der Halbleiterfertigung, entstanden genau aufgrund der Anforderungen, die von diesen staatlichen Kunden formuliert wurden. Der Spitzname „Silicon Valley“ basiert beispielsweise darauf, dass das US-Militär die Entwicklung von Siliziumchips bevorzugte, was die Region als Standort prägte. Auch für die Finanzierung von Start-ups und Hightech-Unternehmen spielte der Staat eine wichtige Rolle.
In den Anfangsjahren des Venture Capital war das Kapital knapp. Staatliche Programme wie die der Small Business Administration unterstützten private Investoren durch Matching-Fonds, sodass risikoreiche Projekte überhaupt erst realisiert werden konnten. Das kapitalintensive Umfeld technologischer Entwicklung und Kommerzialisierung wäre ohne diese staatlichen Interventionen kaum erreichbar gewesen. Die Förderung ebnete den Weg für eine spätere private Kapitalbeteiligung, ohne die Marktkräfte die ganze Last hätten tragen müssen. Doch die Zusammenarbeit zwischen Staat und Technologiebranche änderte sich im Verlauf der Jahrzehnte.
Während in den 1960er und 1970er Jahren öffentliche Institutionen noch umfassend förderten und Innovation aktiv gestalteten, begann ab den 1980er Jahren eine Phase der Deregulierung und Rückzug des Staats aus der aktiven Kommerzialisierung. In der Folge verloren viele Schlüsseltechnologien, etwa im Bereich der Flachbildschirme oder Halbleiterfertigung, an Wettbewerbsfähigkeit. Die technische Führung glitt in Bereiche Ostasiens, insbesondere nach Japan, Taiwan, Südkorea und China. Der US-Markt verließ sich mehr auf ausländische Zulieferer statt eigene Produktion und Innovation voranzutreiben. Auch viele der großen Technologieunternehmen wandelten ihr Geschäftsmodell weg von kapitalintensiver Hardwareentwicklung hin zu leichter skalierbaren Digitaldiensten und Anwendungen.
Die damit verbundenen Innovationen sind fraglos bedeutend, doch handelt es sich oft um softwarebasierte Entwicklungen, die nicht dieselbe langfristige technologische Infrastruktur aufbauen wie früher. Dies hat zu Kritik geführt, dass Silicon Valley heute vor allem „Innovation in Bits“ hervorbringt, weniger aber in Bereichen, die materielle Produktion und systemische technologische Fortschritte betreffen. Eine wichtige Lektion aus der Geschichte von Silicon Valley ist die Bedeutung langfristiger, strategischer Investitionen und der aktiven Rolle des Staates in Entwicklung und Skalierung von Schlüsseltechnologien. Die jüngst verabschiedeten staatlichen Programme wie der CHIPS and Science Act zeigen ein Umdenken in der Politik, das auf eine Rückkehr zu aktiver technologischer Förderung hindeutet. Um die Führungsposition der USA zu sichern und neue Innovationswellen zu ermöglichen, ist eine Kombination aus öffentlichen Mitteln, strategischer Planung und privatem Unternehmertum entscheidend.
Das Beispiel von Elon Musk illustriert den andauernden Stellenwert öffentlicher Förderung. Trotz seines Rufs als unabhängiger Unternehmer profitieren sowohl Tesla als auch SpaceX maßgeblich von staatlichen Subventionen und Aufträgen. Dies widerlegt die Annahme, dass wahrhaft disruptive Innovationen nur aus privaten Initiativen entstehen können, und unterstreicht die Rolle des Staates als „Subsidienbauer“, der durch gezielte Investitionen die Rahmenbedingungen für technologische Durchbrüche schafft. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Mythos des selbsterschaffenen Genies im Silicon Valley der Realität nicht gerecht wird. Innovation entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel von Marktkräften, staatlicher Förderung, wissenschaftlichem Fortschritt und unternehmerischem Glück.
Das privilegierte Bild vom skrupellosen Gründer, der ohne Unterstützung in der Garage ein Imperium aufbaut, blendet all jene Faktoren aus, die technische Innovationen erst möglich machen. Eine realistische Perspektive auf die amerikanische Technologiegeschichte zeigt, dass Fortschritt ohne den entschlossenen und langfristigen Einsatz der öffentlichen Hand undenkbar ist – ein Faktum, das gerade im Zeitalter globaler technologischer Konkurrenz wieder angemessene Beachtung finden sollte.