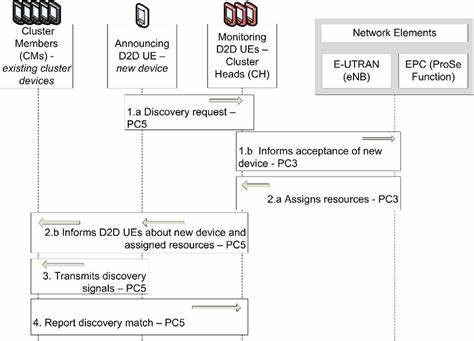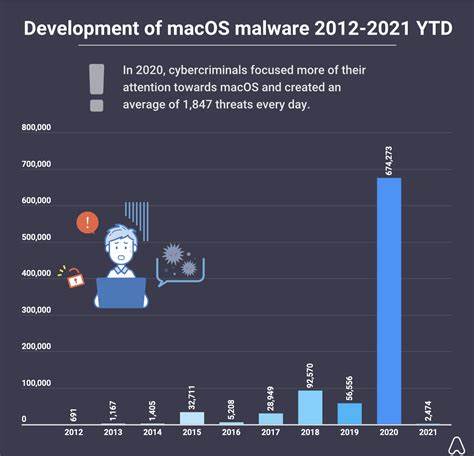Unabhängige Entdeckungen haben die Geschichte der Wissenschaft und Technik immer wieder geprägt. Von den berühmten Fällen wie Isaac Newton und Gottfried Leibniz, die unabhängig voneinander die Infinitesimalrechnung entwickelten, bis hin zu den simultanen Erfindungen von Telefon und Glühbirne gibt es zahlreiche Beispiele, bei denen mehrere Menschen oder Gruppen zur gleichen Erkenntnis kamen, ohne voneinander zu wissen. Doch wie häufig passiert das wirklich? Handelt es sich um seltene Zufälle oder eher um eine natürliche Folge der kumulativen Wissensentwicklung? Diese Frage ist nicht nur von historischem Interesse, sondern hat auch weitreichende Implikationen für unser Verständnis von Innovation und wissenschaftlichem Fortschritt. Die Grundannahme, die hinter der Untersuchung unabhängiger Entdeckungen steht, ist, dass Ideen oder Erfindungen irgendwann sozusagen „in der Luft liegen“. Sobald die Grundlagen geschaffen und das notwendige Vorwissen vorhanden sind, sind viele Erfinder in der Lage, zu ähnlichen Schlussfolgerungen oder Technologien zu gelangen, selbst wenn sie isoliert voneinander arbeiten.
Dies lässt sich anhand zahlreicher anekdotischer Beispiele illustrieren, doch zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass solche Mehrfachentdeckungen zwar möglich, aber keineswegs die Norm sind. Frühe wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Thema beschäftigten, legten nahe, dass ein erheblicher Anteil von Forschern bereits mindestens einmal in ihrer Karriere von anderen „vorgegriffen“ wurde – in der heutigen Terminologie würde man sagen, sie wurden „gescoopt“. Eine Befragung von fast 2000 Forschern aus den 1960er Jahren ergab, dass etwa 63 Prozent zumindest einmal und 16 Prozent sogar mehrmals von unabhängigen Konkurrenten im selben Forschungsfeld überholt wurden. Bedeutender ist jedoch die Tatsache, dass schon zu diesem damaligen Zeitpunkt rund ein Prozent der Befragten angaben, ihre aktuelle Forschung sei bereits von anderen antizipiert worden. Dies legt nahe, dass jährlich einige Prozente der Projekte von unabhängigen Entdeckungen betroffen sind.
Eine neuere und besonders aufschlussreiche Sicht auf das Thema kommt aus dem Bereich der Strukturbiologie. Dort sind Wissenschaftler oft gezwungen, die dreidimensionale Struktur von Proteinen zu entschlüsseln. Die Einreichung der Modelle zu einer zentralen Datenbank vor Veröffentlichung bietet eine einzigartige Möglichkeit, sogenannte Doppelentdeckungen zu erfassen. Das Ergebnis: Auch hier liegt der Anteil von Fällen ähnlicher Entdeckungen, die von verschiedenen Teams unabhängig voneinander gemacht werden, bei etwa zwei bis drei Prozent. Neben wissenschaftlichen Arbeiten wurde das Phänomen auch bei Patenten untersucht.
Besonders im US-Patentsystem bis 2013, als das „First-to-Invent“-Prinzip galt, konnte es zu sogenannten Patentstreitigkeiten kommen, wenn zwei Erfinder zur selben Zeit dieselbe Erfindung angemeldet hatten. Untersuchungen zeigten, dass nur ein verschwindend geringer Bruchteil der Patentfälle von solchen Doppelentwicklungen betroffen war – etwa 0,02 Prozent aller Patentanmeldungen in einem Zeitraum von etwa 15 Jahren. Dies steht im starken Gegensatz zu den rund zwei bis drei Prozent bei wissenschaftlichen Artikeln. Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Entdeckungen und Patentstreitigkeiten kann durch unterschiedliche Faktoren erklärt werden. Patente erfordern in der Regel nicht nur Originalität, sondern auch Neuheit und manchmal eine gewisse Komplexität oder praktische Anwendbarkeit.
Forschungsarbeiten hingegen können präziseren oder leichter zugänglichen Folgefragen nachgehen und sind stärker in einem internationalen und kollaborativen Netzwerk einzubetten, was die Wahrscheinlichkeit für Doppelentdeckungen erhöhen kann. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmter Gedanke, eine technische Neuerung oder wissenschaftliche Erkenntnis wiederentdeckt wird, wenn der ursprüngliche Entdecker ausfällt oder die Entdeckung unterbleibt? Rechnet man mit der obigen Wahrscheinlichkeit von zwei bis drei Prozent für gleichzeitige Entdeckungen während eines Jahres, so ist die Chance, dass niemand innerhalb von zwanzig Jahren diese Idee wiederentdeckt, mehr als 50 Prozent. Wird die Dauer eines Forschungsprojekts aber realistischerweise auf zwei Jahre geschätzt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entdeckung länger verborgen bleibt, noch weiter. Wichtig ist auch die Tatsache, dass der Faktor Zeit und der Kontext, in dem Forschung betrieben wird, eine entscheidende Rolle spielen. Der Zugang zu Informationen, die internationale Vernetzung der Forscher und schnelle Kommunikation fördern Doppelentdeckungen.
Umgekehrt reduzieren Isolation und eingeschränkter Informationsaustausch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Forschungsthemen überlappen. Historische Beispiele sind die wissenschaftliche Isolation während des Ersten Weltkrieges sowie die Forschungsbereiche, die während des Kalten Krieges zwischen Ost und West entstanden. Dort entwickelten sich Wissenschaft und Technologiefelder oft unabhängig voneinander, was bis heute Unterschiede in der theoretischen und angewandten Forschung erklärt. Eine Auswertung der wissenschaftlichen Publikationen während des Ersten Weltkriegs ergab, dass die Schnittmenge der Forschungsthemen zwischen verfeindeten Ländern um etwa 85 Prozent zurückging, zumindest gemessen an der Ähnlichkeit der veröffentlichten Arbeiten. Ebenso zeigen Untersuchungen nach Ende des Kalten Krieges, dass viele bedeutende mathematische Resultate, die in der Sowjetunion entwickelt wurden, im Westen aufgrund der politischen und sprachlichen Barrieren lange unbekannt blieben und erst Jahre nach Öffnung dieser Grenzen ihre volle Wirkung entfalteten.
Diese Beispiele weisen darauf hin, dass die Wiederentdeckung von Wissen nicht automatisch oder gar unmittelbar erfolgt, sondern oft durch sozio-politische Bedingungen und Kommunikationswege geprägt ist. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass nicht alle Entdeckungen dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, unabhängig gemacht zu werden. Gerade besonders bedeutende, bahnbrechende Ideen ziehen oft eine größere Zahl von Forschern an und werden dementsprechend öfter in verschiedenen Kontexten und von unterschiedlichen Personen aufgegriffen. In der Strukturbiologie korreliert die Relevanz eines Proteins stark mit der Anzahl der Forscher, die sich darum bemühen, es zu entschlüsseln. Hohe Sichtbarkeit und potenziell große Auswirkungen einer Entdeckung erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit für unabhängige Mehrfachfunde deutlich.
Dieses Phänomen lässt sich auch im Patentrecht beobachten, wo wertvolle und wirtschaftlich wichtige Patente häufiger im Laufe der Jahre zu Einsprüchen und sogenannten „Infringements“ führen. Das deutet darauf hin, dass bedeutende Erfindungen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deshalb häufiger mit neuen, ähnlichen Anmeldungen konfrontiert werden – was auf mehrere unabhängige Versuche hindeutet. Dennoch überwiegend ist der Forschungsbereich durch eine gewisse Fragilität gekennzeichnet. Für viele Entdeckungen, die erst im Rückblick an Bedeutung gewinnen und nicht sofort als „bahnbrechend“ erkennbar sind, existiert kaum oder gar keine eingebaute Redundanz. Werden sie von den Forschern nicht weiterverfolgt, kann es Jahrzehnte dauern, bis sie wiederentdeckt werden – oder sie bleiben unwiederbringlich verloren.
Im Gegenzug verfügen die großen, perspektivisch klar erkennbaren Durchbrüche meist über einen hohen „Backup“-Effekt, sodass zumindest eine gewisse Sicherheit besteht, dass sie nicht nur einmalig gefunden werden. Auch wenn unabhängige Entdeckungen nicht außergewöhnlich sind, darf man nicht vergessen, dass ein Großteil wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte durch Zusammenarbeit, Kommunikation und Wissenstransfer begünstigt wird. Informationsverfügbarkeit minimiert unnötige Doppelarbeit und lenkt Forscher auf neue, noch unerschlossene Bereiche. Gleichzeitig zeigt die Wahrscheinlichkeit unabhängiger Entdeckungen, dass die Wissenschaft nicht von einzelnen Genies allein abhängt, sondern von einem Netzwerk gleichsam inspirierten Denkens, aus dem immer wieder ähnliche Ideen hervorgehen können. Um das Verständnis für diese Dynamik zu vertiefen, sind weitere systematische Untersuchungen notwendig, die verschiedene Felder, Zeiträume und soziale Faktoren berücksichtigen.