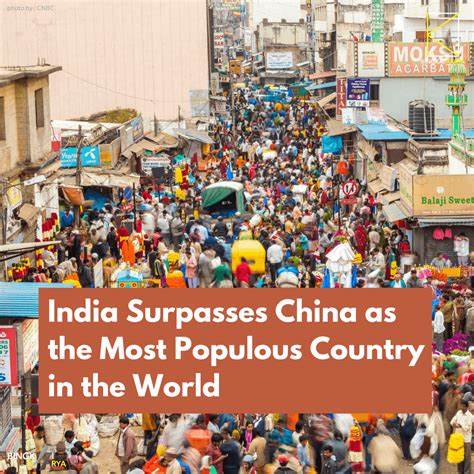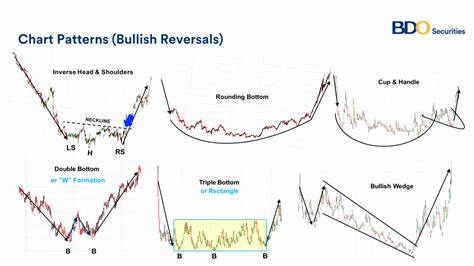Im Jahr 2023 markiert ein historischer Wendepunkt in der globalen Demografie: Indien hat China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt – eine Position, die China seit mindestens 1950 innehatte. Obwohl die offiziellen Zahlen aufgrund einer zuletzt 2011 durchgeführten Volkszählung nicht präzise sind, schätzen die Vereinten Nationen die Bevölkerung Indiens auf über 1,4 Milliarden Menschen, womit das Land jetzt die Spitzenposition einnimmt. Im Gegensatz zur schrumpfenden Bevölkerung Chinas wächst Indiens Einwohnerzahl weiterhin stetig und prägt damit auch die weltweiten Bevölkerungsdynamiken maßgeblich. Die Bevölkerung Indiens ist nicht nur zahlenmäßig überwältigend, sondern zeichnet sich auch durch ihre junge Altersstruktur aus. Über 40 Prozent der Menschen sind unter 25 Jahre alt, was bedeutet, dass rund jeder fünfte junge Mensch weltweit in Indien lebt.
Mit einer mittleren Altersanzahl von etwa 28 Jahren ist Indien deutlich jünger als China mit einem Medianalter von 39 Jahren und die Vereinigten Staaten, deren Medianalter bei 38 Jahren liegt. Diese junge Bevölkerung bietet dem Land sowohl Chancen als auch Herausforderungen – von einem potenziellen demografischen Bonus bis hin zur enormen Verantwortung, ausreichend Bildung, Arbeitsplätze und soziale Infrastruktur bereitzustellen. Chinas Bevölkerung hingegen verzeichnet bereits seit einigen Jahren einen Rückgang, was vor allem auf eine alternde Bevölkerung und niedrige Geburtenraten zurückzuführen ist. In Indien dagegen sinkt die Kinderzahl pro Frau zwar auch, jedoch in einem geringeren Ausmaß. Die durchschnittliche indische Frau bringt heute etwa zwei Kinder zur Welt, was über Chinas Fertilitätsrate von 1,2 und der von etwa 1,6 in den USA liegt, aber deutlich unter den früheren Werten in Indien – in den 1950er Jahren lag die Geburtenrate bei fast sechs Kindern pro Frau.
Der Rückgang der Fruchtbarkeit ist in allen religiösen Gemeinschaften des Landes zu beobachten, von der hinduistischen Mehrheit bis zu Minderheiten wie Muslimen, Christen, Sikhs, Buddhisten und Jains. Besonders bemerkenswert ist der Rückgang der Geburtenrate unter indischen Muslimen, von 4,4 Kindern pro Frau im Jahr 1992 auf 2,4 im Jahr 2019. Die demografischen Unterschiede innerhalb Indiens sind ebenso markant wie die Trends auf nationaler Ebene. So variieren die Geburtenraten stark zwischen urbanen und ländlichen Gebieten sowie von Bundesstaat zu Bundesstaat. Frauen in ländlichen Regionen haben im Durchschnitt 2,1 Kinder, während der Wert in städtischen Gebieten auf 1,6 sinkt.
Dieser Unterschied ist auch ein Spiegelbild sozioökonomischer Faktoren wie Bildungsstand, Wohlstand und Zugang zu Gesundheitsdiensten. So ist die durchschnittliche Anzahl von Kindern pro Frau seit 20 Jahren signifikant gesunken: Damals betrugen die Zahlen 3,7 in ländlichen und 2,7 in städtischen Gebieten. Auch auf staatlicher Ebene gibt es starke Unterschiede. Bundesstaaten wie Bihar und Meghalaya weisen mit fast drei Kindern pro Frau die höchsten Geburtenraten auf, während Sikkim und Goa zahlen nahe oder unter der Ersatzfertilitätsrate von etwa 1,3 aufweisen. Diese variierenden Wachstumsraten spiegeln wirtschaftliche Gegebenheiten, Lebensqualität und Zugang zu Bildungs- und Gesundheitsressourcen wider.
Bundesstaaten mit höherem Wirtschaftswachstum und besserer Infrastruktur verzeichnen häufig geringere Bevölkerungszuwächse, während strukturelle Herausforderungen in ärmeren Regionen zu höheren Fertilitätsraten beitragen. Indiens Bevölkerung wächst also nicht nur, sondern verändert sich auch alters- und geburtenmäßig. Die mittlere Geburtsalter der Frauen hat sich ebenfalls verschoben. Frauen in städtischen Gegenden bekommen ihr erstes Kind durchschnittlich 1,5 Jahre später als Frauen auf dem Land. Diese Tendenz verstärkt sich mit steigendem Bildungsniveau und höherem Wohlstand.
So liegt das mediane Alter für die erste Geburt bei gebildeten Frauen mit mehr als zwölf Jahren Schulbildung bei fast 25 Jahren, während Frauen ohne Schulbildung bereits mit knapp 20 Jahren ihre erste Geburt haben. Ähnliches gilt für unterschiedliche Wohlstandsschichten, wobei wohlhabendere Frauen erst später Mutter werden. Ein interessantes demografisches Detail ist das Geschlechterverhältnis bei der Geburt in Indien. Von einem übermäßigen Anteil an Jungen bei etwa 111 Jungen auf 100 Mädchen im Jahr 2011 hat sich das Verhältnis in den letzten Jahren auf ca. 108 Jungen pro 100 Mädchen verringert.
Diese Verschiebung ist Folge einer Abschwächung der Praxis der geschlechtsselektiven Abtreibung, die in den 1970er Jahren mit neuen pränatalen Diagnosetechnologien an Bedeutung gewonnen hatte. Laut Studien ist die Zahl der fehlenden Mädchen jährlich von etwa 480.000 im Jahr 2010 auf 410.000 im Jahr 2019 gesunken. Neben der Fertilitätsrate haben auch andere Faktoren das Bevölkerungswachstum beeinflusst.
Die Infantile Sterblichkeitsrate in Indien hat sich in den letzten 30 Jahren dramatisch verbessert und ist von 89 Todesfällen je 1.000 Neugeborener im Jahr 1990 auf 27 im Jahr 2020 zurückgegangen. Trotz dieser Erfolge bleibt die Rate im Vergleich zu Nachbarländern wie Bangladesch, Nepal, Bhutan und Sri Lanka hoch. Selbst im internationalen Vergleich liegt Indien bei den Kindersterblichkeitsraten noch über Ländern mit ähnlicher Bevölkerung, wie China oder den USA. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Bevölkerungsentwicklung ist die Migration.
Indien verzeichnet seit Jahren mehr Abwanderung als Zuwanderung, was zu einer negativen Netto-Migration führt. So verlor das Land 2021 etwa 300.000 Menschen durch Migration. Dies ist ein bemerkenswerter Aspekt, da Indien trotz des Bevölkerungswachstums in einzelnen Jahren auch Zuwächse durch Migration verzeichnete, insbesondere im Jahr 2016 mit der Aufnahme von Flüchtlingen wie den Rohingya aus Myanmar. Die projizierten Daten der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass diese negative Netto-Migration mindestens bis 2100 bestehen bleibt.
Die Folgen und Chancen dieser demografischen Transformation Indiens sind vielschichtig. Auf der einen Seite verspricht die junge Bevölkerung einen demografischen Vorteil, der das wirtschaftliche Wachstum beschleunigen und die globale Stellung Indiens stärken könnte. Auf der anderen Seite stehen große Herausforderungen, wie etwa die Bereitstellung von ausreichend Arbeitsplätzen, Bildungsangeboten und Gesundheitsversorgung für eine wachsende Bevölkerung. Zudem muss das Land soziale und infrastrukturelle Ungleichheiten abbauen, um ein nachhaltiges Wachstum und sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten. Indiens Trend zur Urbanisierung spielt dabei ebenfalls eine Rolle.
Während viele Bürger in Städte ziehen, verschieben sich Arbeitsmärkte und Lebensstile. Bildung und Zugang zu Gesundheitsdiensten werden im urbanen Raum leichter verfügbar, was zu niedrigeren Fertilitätsraten führt. Doch die Urbanisierung bringt auch Herausforderungen wie Überbevölkerung in Städten, Verkehrsprobleme und Umweltbelastungen mit sich. Vor dem Hintergrund der langfristigen UN-Projektionen wird erwartet, dass Indiens Bevölkerung bis Mitte des Jahrhunderts weiter auf etwa 1,7 Milliarden Menschen ansteigt, bevor sie langsam zu sinken beginnt. In Szenarien mit höherer Fertilität könnte die Bevölkerung sogar 2 Milliarden bis 2068 erreichen.