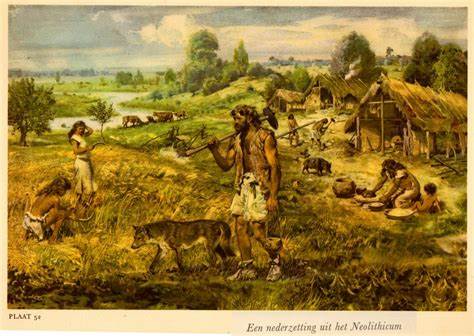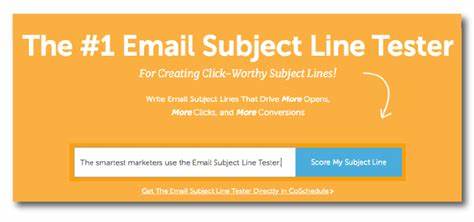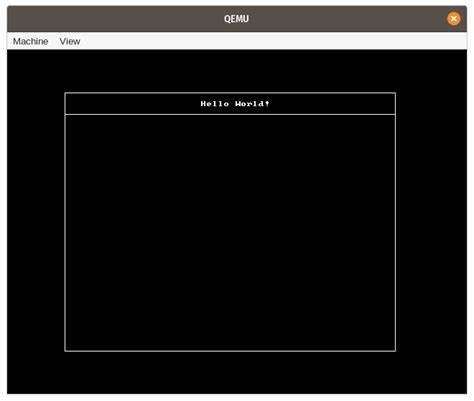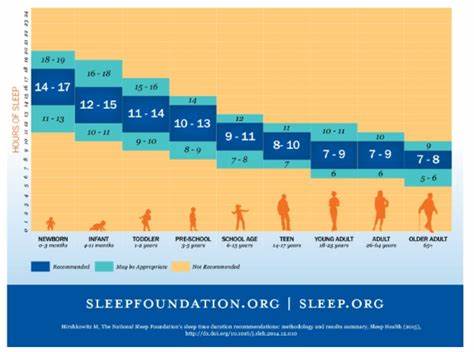Im südlichen Levantegebiet, einer Schlüsselregion für die Entwicklung der frühen Landwirtschaft, deuten neue Forschungen darauf hin, dass katastrophale Feuerereignisse und die damit verbundene Bodendegradation eine bedeutende Rolle bei der Auslösung der neolithischen Revolution gespielt haben könnten. Die neolithische Revolution beschreibt den tiefgreifenden Wandel von nomadischen Jäger- und Sammlergesellschaften zu sesshaften Ackerbauern und Viehzüchtern und markiert somit einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Die Ursachen für diese Entwicklung waren lange umstritten, häufig standen anthropogene Faktoren oder schrittweise kulturelle Evolution im Vordergrund. Aktuelle Studien aus geowissenschaftlichen und archäologischen Analysen weisen jedoch auf einen stärkeren Einfluss von natürlichen Umweltkatastrophen, vor allem intensiven Feuern und deren Auswirkungen auf den Boden, hin. Die geologische und klimatische Historie des südlichen Levantegebiets offenbart eine Phase in der frühen Holozänzeit – insbesondere zwischen etwa 8600 und 8000 v.
Chr. –, in der außergewöhnlich starke Brände auftreten, die in verschiedenen Sedimentkernen anhand von Mikro-Kohlenstoffpartikeln und anderen Proxy-Daten nachweisbar sind. Gleichzeitig zeigen sich Indikatoren für eine dramatische Veränderung der Vegetationsdecke und eine großflächige Bodenerosion. Die Verluste der fruchtbaren Terra-Rossa-Böden an Berghängen führten zur Ablagerung dieser Böden in Tälern und Niederungen, wodurch fruchtbare, landwirtschaftlich nutzbare Bodenschichten entstanden. Es entsteht somit ein Bild eines von Bränden verwüsteten, jedoch durch nachströmende Biomasse und Bodenschwemme neu geschaffenen Lebensraums.
Die Ursprünge dieser intensiven Feuerphase lassen sich nicht eindeutig anthropogen erklären, zumal die Feuer zeitlich mit klimatisch bedingten Veränderungen korrelieren. Während vielerorts die Annahme herrschte, dass frühe neolithische Gemeinschaften kontrolliert Feuer als Landmanagement-Strategie einsetzten, deuten isotopische Analysen und Klimaarchive auf eine natürliche Entzündung durch eine Zunahme von Blitzschlägen hin. Diese wiederum sind durch orbital-gesteuerte Veränderungen der Sonneneinstrahlung und eine kurzfristige Verschiebung des südlichen Klimagürtels bedingt. Die sogenannten Trockenblitzgewitter brachten im Rahmen einer Phase, die als 8,2-Kilojahres-Ereignis bekannt ist, eine Trockenheit, die Vegetationsverlust und Brandhäufigkeiten verstärkte. Die Verschlechterung der Bodenqualität und die Entfernung der schützenden Vegetationsschicht zwangen die frühen Menschen, ihre Lebensweise anzupassen.
Die ehemals gut bewaldeten und bewachsenen Hügel wurden zunehmend unfruchtbar und instabil, weshalb Gemeinschaften sich in den Tälern mit den neu abgelagerten fruchtbaren Böden konzentrierten. Diese neu entstandenen, wasserreichen Areale boten eine günstige Grundlage für den Aufbau erster großer neolithischer Siedlungen und die Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht. Der Zusammenhang zwischen dieser Umweltkatastrophe und der sozialen Umorientierung hin zu sesshafter Landwirtschaft wird durch die Datierung archäologischer Stätten auf den natürlichen Bodenaanschwemmungen in Tälern unterstützt. Spezielle Methoden wie die Analyse von 87Sr/86Sr-Isotopen in Höhlenspeothem-Proben zeigen, dass die Überreste des Bodens während der Neolithikums-Periode tiefgreifenden Veränderungen unterlagen. Die Strontium-Isotopensignaturen legen nahe, dass größere Landabschnitte entblößt wurden, während in den Tälern die Böden angereichert und somit landwirtschaftlich interessant wurden.
Auch die Kohlenstoffisotope weisen darauf hin, dass von C3-Vegetation (typische Laub- und Nadelbäume) auf offenere Landschaften und Savannen-ähnliche Bedingungen mit überwiegend grasartiger Vegetation umgestellt wurde. Diese Umweltumbrüche sind keineswegs ein isoliertes Ereignis. Vergleiche mit früheren wärmeren Perioden der Erdgeschichte, wie dem Interglazial MIS 5e vor etwa 125.000 Jahren, zeigen ähnliche Muster von intensiven Feuerereignissen, Vegetationsverlust und Bodenabtragungen, die offenbar zyklisch mit orbitalbedingten Klimaschwankungen korrelieren. Dies zeigt, dass die Landschaft des südlichen Levantegebiets stark durch Feuer dynamisiert wurde und diese Prozesse die Umweltbedingungen langfristig prägten.
Während anthropogene Einflüsse auf Feuer und Landschaftsmanagement sicherlich eine Rolle in der Evolution der Menschheit spielten, bleibt die Erkenntnis zentral, dass die naturräumlichen Konditionen die Grundlage für wichtige kulturelle und technologische Innovationen bildeten. Das katastrophale Episoden von Feuer und Bodendegradation möglicherweise eine wichtige treibende Kraft bei der Herausbildung komplexer Siedlungen und landwirtschaftlicher Praktiken waren, stellt eine bedeutende Erweiterung des Verständnisses der Neolithischen Revolution dar. Die Rolle von Feuer als ökologischer und kultureller Faktor im Mittelmeerraum hat darüber hinaus Folgen für das heutige Umweltmanagement. Die natürlichen Feuerzyklen, die in dieser Region lange vor der modernen menschlichen Zivilisation existierten, beeinflussten die Zusammensetzung der Flora, Bodenbeschaffenheit und den Wasserhaushalt. Das Wissen um Feuer als natürlichen Regulator kann daher helfen, heutige Waldbrandrisiken besser einzuschätzen und mit der Landschaft in Einklang zu bringen.
Die neolithischen Siedlungen, die auf den abgelagerten fruchtbaren Böden entstanden, spiegeln die Reaktion des Menschen auf komplexe Umweltveränderungen wider. Große Siedlungen wie Jericho, Gilgal oder Motza wurden auf eben solchen Terrassen und Bodenanhäufungen errichtet. Ihre Existenz zeigt, wie Menschen auf diese neuen Chancen reagierten und Landwirtschaft sowie domestizierte Tierhaltung entwickelten, um die Versorgung ihrer Gemeinschaften zu sichern. Ein weiterer interessanter Aspekt sind Hinweise auf kognitive und kulturelle Anpassungen, welche die Menschen während dieser Zeit vollzogen. Die immer komplexeren Siedlungen und der erstmals dokumentierte Zugang zu tieferen und schwieriger zugänglichen Höhlensystemen weisen auf eine steigende soziale Organisation, symbolische Verhaltensweisen und technologische Innovationen hin, die als Reaktion auf die Umweltkrisen interpretiert werden können.