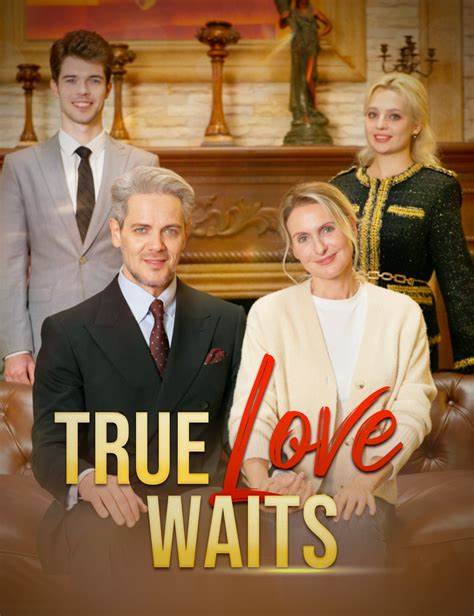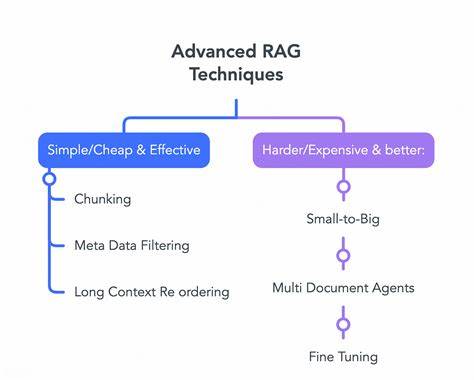Das Thema digitale Souveränität gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung. Vor allem im Bereich der Internetinfrastruktur versuchen politische Entscheidungsträger und Institutionen, die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu reduzieren und eine sichere, datenschutzkonforme Umgebung für europäische Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Eines der Projekte, das in diesem Kontext immer wieder hervorgehoben wird, ist DNS4EU – eine Initiative, die von der Europäischen Agentur für Cybersicherheit (ENISA) unterstützt wird und als sichere, resilient gestaltete Domain Name System (DNS)-Infrastruktur für die EU gilt. Doch wie viel „EU“ steckt wirklich in DNS4EU? Steht das Projekt tatsächlich für europäische Unabhängigkeit, oder verbergen sich hinter der Fassade international agierende Konzerne? Diese Frage wollen wir anhand einer technischen und faktischen Analyse näher beleuchten, um Klarheit in die Debatte rund um das Projekt DNS4EU zu bringen. DNS4EU versteht sich als Antwort der Europäischen Union auf den wachsenden Bedarf nach einer sicheren und datenschutzfreundlichen DNS-Infrastruktur.
DNS ist ein essenzieller Bestandteil des Internets – es übersetzt menschenlesbare Domains in IP-Adressen. Dadurch entscheidet die DNS-Infrastruktur direkt mit darüber, wie sicher und privat die Datenverbindungen der Nutzer sind. Die EU möchte mit DNS4EU eine Infrastruktur schaffen, die europäischen gesetzlichen Vorgaben entspricht und so Daten- und Netzsicherheit gewährleistet. Ein erster Schritt zu überprüfen, wie europäisch DNS4EU tatsächlich ist, beginnt bei einer einfachen DNS-Abfrage. Unter anderem zeigt ein Blick auf die Nameserver der Domain joindns4.
eu interessante Details. Die Antwort auf die Abfrage listet drei Nameserver auf: ns61.cloudns.net, ns63.cloudns.
net und ns64.cloudns.uk. Auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass zwei der drei Server unter einer europäischen Domain namens cloudns.net laufen, die mit der europäischen Firma ClouDNS assoziiert wird.
Der dritte Server wird unter cloudns.uk geführt, was Großbritannien bedeutet – geografisch nahe, politisch allerdings nach dem Brexit nicht mehr Teil der EU. Durch weitere Untersuchungen der IP-Adressen, sowohl IPv4 als auch IPv6, zeigen sich interessante Fakten. Alle drei Adressen lassen sich bei der IP-Adressvergabe durch regionalen Internet-Registries bis hin zu europäischen Organisationen zurückverfolgen. Dies spricht dafür, dass zumindest die Nameserver physisch in der EU angesiedelt sind oder von europäischen Dienstleistern betrieben werden.
So fällt die Bilanz für diesen Teil der Infrastruktur vorerst zugunsten der EU aus. Anders sieht es aus, wenn man einen Blick auf die Webseite www.joindns4.eu wirft. Die Domain wird als Alias zu einer Adresse mit dem Namen hscoscdn-eu1.
net geführt, was auf ein Content Delivery Network (CDN) hindeutet. Die IP-Adressen der Seite sind dem Unternehmen Cloudflare zugeordnet. Cloudflare ist ein amerikanischer Dienstleister und damit kein europäischer Akteur. Die IP-Adressen und die Kontrolle über die eigenen Inhalte liegen demnach letztendlich außerhalb der EU, was die Bewertung durch die Lupe zeigt. Die Dienste am Frontend und die Präsentation stehen also auf einer nicht ganz europäischen Basis.
Dies zeigt sich auch in der Bilanz, die sich hier ein Minuspunkt für europäische Exklusivität darstellt. Einen weiteren Blick auf die Mail-Infrastruktur gönnte sich die Analyse ebenfalls. DNS4EU nutzt Google Mail-Server als Postausgang. Google ist ebenfalls eine US-amerikanische Firma, sodass wesentliche Kommunikationswege nicht in der EU verbleiben. Auch wenn DNS4EU kein Projekt ist, das primär E-Mail-Dienste abdecken will, so ist es doch interessant, dass die Infrastruktur überhaupt nicht europäisch geprägt ist.
Die Abhängigkeit von amerikanischen Diensten bleibt damit hoch. Den zentralen Punkt für DNS4EU stellen jedoch die DNS-Resolver dar. Diese Resolver sind die Komponenten, die von Nutzern konfiguriert werden sollen, damit Anfragen über DNS4EU laufen. Hier befindet sich angeblich die volle Kontrolle der EU, da die IPv4- und IPv6-Adressbereiche, die zu den Resolvern gehören, von europäischen Unternehmen registriert wurden. Die Adressen 2a13:1001::86:54:11:/64 und 86.
54.11.100/24 etwa sind zu europäischen Firmen zuordenbar. Doch es genügt nicht, nur den Besitzer der IP-Adressen zu betrachten. Das Routing und die technische Weiterleitung der Datenpakete erfolgt über das Border Gateway Protocol (BGP), das den Weg im Internet bestimmt.
Die Analyse der zuständigen AS-Nummern (Autonomous System Numbers) – also der Netzwerke, die den Datenverkehr weiterleiten – zeigt, dass wesentliche Datentransite über nicht-europäische AS-Nummern gehen. In einem untersuchten Fall war der Haupt-Transitmanager in Großbritannien ansässig, einem Land, das nach dem Brexit nicht mehr EU-Mitglied ist und zudem Teil des sogenannten Five Eyes Geheimdienstnetzwerks. Diese Tatsache ist ein wichtiger Punkt, da das Projekt DNS4EU die digitale Souveränität stärken will. Wenn der Datenverkehr jedoch über Dritte außerhalb der EU geleitet wird, können Datenschutz und Sicherheit nicht komplett gewährleistet werden. Die EU verliert so einen Teil ihrer Kontrolle und ist abhängig von Infrastrukturen, die möglicherweise unter fremden Rechtsprechungen und Geheimdienstinteressen stehen.
Neben der Herkunft und Kontrolle der technischen Infrastruktur wirft die Analyse auch die Frage nach der Verfügbarkeit und Redundanz auf. DNS ist ein kritischer Dienst, dessen Ausfall gravierende Folgen haben kann. Eine moderne DNS-Infrastruktur sollte daher mehrfach abgesichert und über diverse Provider sowie Standorte in der EU verteilt sein. DNS4EU scheint auf den ersten Blick stark „single-homed“ zu sein, das heißt, es ist nicht über mehrere unabhängige Anbieter realisiert. Dadurch ist das Risiko höher, dass Ausfälle oder Angriffe die gesamte Infrastruktur treffen, ohne dass es Backup-Systeme in der gleichen Rechtsprechung gibt.
Dies ist eine Schwachstelle vor allem im Kontext von Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffen, die das Potenzial haben, wichtige Dienste außer Gefecht zu setzen. Eine anycastbasierte Umsetzung über viele unabhängige Provider mit redundanter Infrastruktur wäre hier wünschenswert, ist aber bei DNS4EU nicht klar ersichtlich. Das wirft bei einem EU-finanzierten Projekt Fragen nach der technischen Umsetzung und den strategischen Zielen auf. Die EU will einerseits mehr Unabhängigkeit und Sicherheit erreichen, nutzt aber in der Praxis große Teile von ausländischen Anbietern. Dies liegt zum Teil daran, dass europäische Anbieter in der Breite und Tiefe solcher Netzwerk- und Cloudservices nach wie vor nicht in vergleichbarem Maße verfügbar oder konkurrenzfähig sind wie internationale Großkonzerne.
Ein weiterer Aspekt, der die Diskussion erschwert, ist der Name DNS4EU. Manche Kritiker weisen darauf hin, dass das Projekt eben nur die DNS-Infrastruktur betrifft, nicht gesamte Serviceangebote wie Mail oder Webhosting. Auch wenn die Nutzer für Mail oder Webdienste auf andere Anbieter setzen, sollte die Kernfunktion DNS tatsächlich europäisch sein. Die Analyse zeigt jedoch, dass sich auch hier Kompromisse bei der Implementierung ergeben haben. In der Gesamtbetrachtung stellt sich DNS4EU als ein hybrides Projekt dar.
Die Entwickler und Initiatoren bemühen sich klar um europäische Standards, Datenschutz und hohes Sicherheitsniveau. Die technische Infrastruktur ist zumindest teilweise in der EU lokalisiert, wird aber auf verschiedenen Ebenen, insbesondere beim Routing, von ausländischen Partnern durchkreuzt. Zudem wird die öffentliche Darstellung durch amerikanische Frontend-Anbieter und Mailserver ergänzt, sodass ein vollständig europäisches Ökosystem derzeit nicht gegeben ist. Für Nutzer und Entscheider stellt sich daher die Frage, wie sie mit DNS4EU umgehen sollten. Einerseits ist das Projekt ein wichtiger Schritt, der europäische Interessen im Internet weiter voranbringt und den Grundstein für mehr digitale Selbstbestimmung legen kann.
Andererseits zeigt die Realität, dass der Weg zur echten digitalen Souveränität noch weit ist und durch wirtschaftliche, technologische und politische Herausforderungen erschwert wird. Zukünftige Entwicklungen könnten solche Schwachstellen reduzieren. Die EU könnte sich darauf konzentrieren, weitere europäische Infrastruktur-Pools aufzubauen, die unabhängiger von internationalen Dienstleistern sind. Der Aufbau vielfältiger, sich gegenseitig ergänzender DNS-Systeme mit strikter EU-Kontrolle und einer aufwendigen geografischen und rechtlichen Absicherung erscheint sinnvoll. Ebenso wäre ein Fokus auf anycast-Implementierungen und hohe Redundanz über mehrere Standorte und Anbieter innerhalb Europas wünschenswert.
Ein weiteres zentrales Thema ist die Breite des europäischen Marktangebots in den Bereichen Cloud, Netzwerk und Internetservices. Momentan sind viele Dienste, die eigentlich von europäischen Unternehmen angeboten werden könnten, durch marktbeherrschende US-amerikanische Firmen dominiert. Erst wenn hier genügend Wettbewerb, Innovation und technologische Eigenständigkeit entstehen, wird die EU ihre digitale Unabhängigkeit stärken können. Letztendlich ist DNS4EU ein Symbol sowohl für den Fortschritt als auch die bestehenden Defizite in Europas Digitalisierung. Es zeigt ambitionierte Ziele und politische Unterstützung, offenbart aber auch die technischen und strukturellen Herausforderungen, vor denen die EU steht.
Für eine nachhaltige Lösung bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, der Infrastruktur, Regulierung, Wirtschaftsförderung und internationale Kooperationen miteinander verbindet. Die Bewertung, wie viel EU wirklich in DNS4EU steckt, fällt also ambivalent aus. Auf der einen Seite ein Projekt mit vereinnahmter europäischer Identität und klaren Zielsetzungen, auf der anderen Seite eine Umsetzung, die in entscheidenden Bereichen noch stark auf internationale Partnerschaften angewiesen ist. Wer sichere, datenschutzkonforme und souveräne digitale Dienste in Europa fördern möchte, muss diese Zwiespältigkeit annehmen und an ihr arbeiten, um in Zukunft echte Alternativen zu globalen Anbietern zu schaffen.