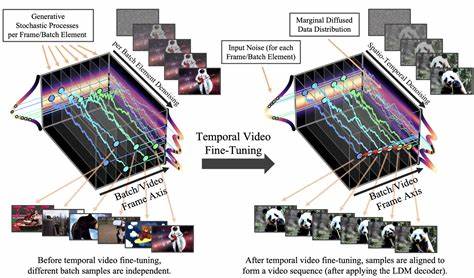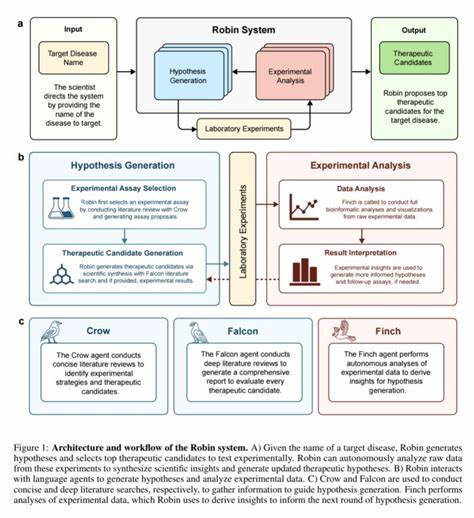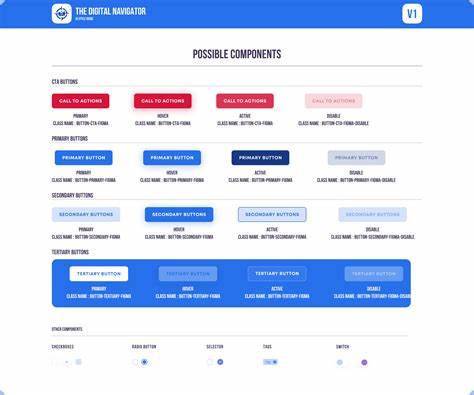In den letzten Jahren wurde die Trans-Gesundheitsforschung immer wieder zum Ziel politischer Angriffe und Einsparungen erklärt. Besonders unter der Trump-Administration kam es zu massiven Kürzungen bei Fördermitteln für Studien, die sich mit den spezifischen Gesundheitsbedürfnissen von trans Personen auseinandersetzen. Diese Einschnitte wurden öffentlich (und öffentlichkeitswirksam) damit gerechtfertigt, dass solche Forschung unwissenschaftlich, unnötig oder gar eine Verschwendung von Steuergeldern sei. Doch wie sehen die Fakten wirklich aus, und was bedeuten diese Entscheidung für die Arbeiterklasse und die Gesellschaft insgesamt? Wenn man über die Vorteile oder angeblichen Nachteile von Kürzungen in der Trans-Gesundheitsforschung spricht, darf eines nicht außer Acht gelassen werden: Die Realität transgeschlechtlicher Menschen ist untrennbar mit gesundheitlichen Ungleichheiten und sozialen Kämpfen verbunden, die weit über eine kleine Minderheit hinausgehen. Trans Menschen zählen nicht nur zu einer besonders marginalisierten Gruppe, sie erleben auch in vielerlei Hinsicht deutlich schlechtere gesundheitliche Verhältnisse als die Gesamtbevölkerung.
Studien haben mehrfach belegt, dass Trans-Personen deutlich höhere Risiken für Erkrankungen wie Brustkrebs, Demenz und HIV tragen. Insbesondere junge trans Menschen und trans Frauen afroamerikanischer Herkunft sind überproportional von HIV betroffen. Auch Suchtkrankheiten sind signifikant häufiger – Trans-Erwachsene haben beispielsweise ein vierfach erhöhtes Risiko, an einer Substanzgebrauchsstörung zu leiden, und trans Jugendliche verwenden häufiger illegale Drogen als nicht-trans Jugendliche. Diese gesundheitlichen Disparitäten zeigen klar, dass Forschung auf diesem Gebiet keineswegs überflüssig ist. Im Gegenteil: Solche Erkenntnisse sind lebensrettend.
Sie ermöglichen es Ärztinnen und Ärzten, ihre Behandlungsmethoden besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse dieser Menschen abzustimmen und damit die medizinische Versorgung zu verbessern. Dass jedoch Forschung auf diesem Gebiet wegen vermeintlicher Unwissenschaftlichkeit kritisiert wird, entbehrt jeder Grundlage. Es ist gerade die Forschungsarbeit, die feststellt, ob beispielsweise Hormontherapien tatsächlich gesundheitliche Risiken bergen oder ob geschlechtsangleichende Operationen langfristig Schäden hervorrufen. Ohne wissenschaftlich fundierte Studien bliebe dieser Bereich komplett im Dunkeln – medizinische Behandlungen würden auf Annahmen basieren statt auf objektiven Erkenntnissen. Dabei profitieren nicht nur trans Menschen von diesen Studien.
Die Erforschung von Hormoneinflüssen etwa hat auch grundlegende Bedeutung für viele cisgender Frauen, die etwa während der Menopause oder zur Osteoporose-Prävention Hormone einnehmen. Der menschliche Körper ist ein komplexes System, das hormonelle Einflüsse auf vielfältige Weise integriert – besseres Verständnis daraus kann zahlreichen Menschen zugutekommen. Die Kritik an den vermeintlich hohen Steuerausgaben für Trans-Gesundheitsforschung ist inhaltlich ebenfalls falsch. Die Mittel, die der National Institutes of Health (NIH) in diesen Bereich investierte, sind verschwindend gering im Verhältnis zum Gesamtetat. Im Jahr 2022 betrugen Ausgaben für LGBTQ-Gesundheitsstudien rund 83 Millionen US-Dollar, was nur etwa 0,1 Prozent der Gesamtmittel entspricht.
Zudem werden Forschungsergebnisse häufig gezielt verzerrt, um den Eindruck von Verschwendung zu vermitteln und die Öffentlichkeit gegen diese Projekte aufzubringen. Ein häufig verwendetes Beispiel ist eine Studie, in der Mäusen Hormontherapien verabreicht wurden, um langfristige Wirkungen auf Organe und Krebsrisiken besser zu verstehen. Diese Versuche werden fälschlicherweise als „Versuche, Mäuse transgender zu machen“ dargestellt, was irreführend und wissenschaftlich unhaltbar ist. Eine weitere Ironie besteht darin, dass jene, die Forschung zur Trans-Gesundheit kritisieren, oftmals gleichzeitig Mittel für Studien zum sogenannten „Bedauern“ nach geschlechtsangleichender Behandlung fordern. Dabei zeigen ergebnisstarke Studien, dass das Bedauern bei nur etwa einem Prozent der Betroffenen auftritt, häufig wegen Verbesserungswünschen bei Operationsergebnissen.
Vielmehr zeigt dies, dass zusätzliche Forschungsressourcen für die Weiterentwicklung chirurgischer Methoden dringend nötig sind. Die Idee, dass Forschung über eine relativ kleine Minderheit keine Vorteile für die breite Bevölkerung bringt, ist nicht nur kurzsichtig, sondern auch vollkommen falsch. Die Lebensrealitäten von Trans Menschen spiegeln sehr oft den sozioökonomischen Status wider, der ein weit aussagekräftigerer Prädiktor für gesundheitliche Chancen und Risiken ist als etwa die Zugehörigkeit zum Transgender-Spektrum oder nicht. Ziel hierbei ist es nicht, Gruppen gegeneinander auszuspielen, sondern die Gemeinsamkeiten der sozioökonomischen Herausforderungen sichtbar zu machen, die eine große Zahl der armen und arbeitenden Bevölkerung betrifft. So leben nahezu ein Drittel aller Trans Personen in Armut und etwa jeder vierte junge Trans Mensch ist vom Verlust der Wohnung bedroht oder bereits obdachlos.
Diese sozioökonomischen Schwierigkeiten wirken sich massiv auf Gesundheitsversorgung, Lebensqualität und psychisches Wohlbefinden aus. Die Erforschung dieser Zusammenhänge und der gesundheitlichen Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen kann letztlich die Zugänglichkeit und Qualität des Gesundheitssystems insgesamt verbessern. Wissenschaft lebt von Vielfalt und Inklusion. Die Berücksichtigung von marginalisierten Gruppen hat zu einigen der bedeutendsten medizinischen Entdeckungen geführt. Ein berühmtes Beispiel ist die Erforschung genetischer Faktoren bei Herzkrankheiten, bei der die Einbeziehung von Schwarzen in Studien neue genetische Mutationen entdeckte.
Daraus konnten wirksame neue Arzneien gegen Bluthochdruck, Herzleiden und erhöhte Cholesterinwerte entwickelt werden. Ähnlich kann die verstärkte Erforschung spezifischer Bedürfnisse von Trans-Menschen auch zu medizinischen Fortschritten führen, die vielen Menschen nützen. Nicht zuletzt sind Kürzungen der Trans-Gesundheitsforschung keine isolierte Maßnahme. Sie fügen sich ein in einen größeren gesellschaftlichen Angriff auf die demokratischen Rechte und die Teilhabe aller besonders marginalisierter Gruppen der Arbeiterklasse. Im Jahr 2025 wurden mehr als 850 anti-trans Gesetze vorgeschlagen, und zahlreiche Maßnahmen richten sich gegen die Rechte und die Sichtbarkeit von Trans-Menschen in Schulen und öffentlichen Institutionen.
Untersuchungen belegen, dass solche politischen Angriffe zu einem erhöhten Risiko von Selbstmordversuchen bei trans und nicht-binären Jugendlichen führen – in manchen Studien zeigt sich eine Erhöhung um bis zu 72 Prozent. Damit stellen diese Maßnahmen nicht nur eine Einschränkung wissenschaftlicher Freiheit und medizinischer Entwicklung dar, sondern auch eine direkte Bedrohung für das Leben und die Gesundheit vulnerable Gruppen. Die sozialen Kämpfe gegen diese Angriffe sind Teil einer umfassenderen Bewegung für soziale Gerechtigkeit und die Verteidigung demokratischer Errungenschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisieren Proteste und Demonstrationen, um auf die Bedeutung von Forschung und Inklusion hinzuweisen. Diese Debatten sind aber nicht isoliert zu betrachten, sondern müssen in Zusammenhang mit weiteren gesellschaftlichen Forderungen verstanden werden, etwa gegen studentische Repressionen, Einschränkungen bei Bildungsausgaben und systemischen Ungerechtigkeiten.
Zusammenfassend zeigt sich, dass Kürzungen bei der Trans-Gesundheitsforschung keinen Nutzen für die Arbeiterklasse bringen. Im Gegenteil: Sie greifen eine ohnehin schwache und diskriminierte Bevölkerungsgruppe an, gefährden medizinische Fortschritte, verschärfen gesundheitliche Ungleichheiten und wirken sich langfristig negativ auf alle Menschen aus. Wissenschaftliche Forschung über Geschlecht, Gesundheit und Soziales dient dem Fortschritt der gesamten Gesellschaft und muss als wesentlicher Bestandteil eines gerechten Gesundheitssystems verstanden werden. Eine inklusive, solidarische Gesellschaft braucht fundierte Forschung, die alle Menschen berücksichtigt – auch solche, die lange Zeit an den Rand gedrängt wurden. Nur so können wir sicherstellen, dass die medizinische Versorgung tatsächlich allen zugutekommt, die sie benötigen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status.