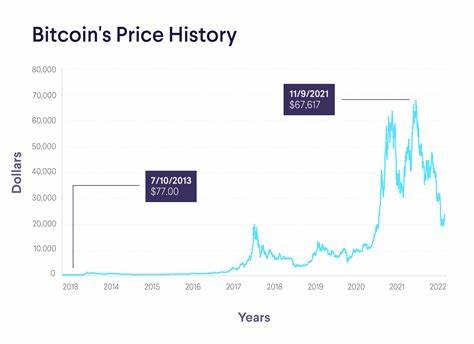Die Ankündigung von Präsident Donald Trump, die Pharmaindustrie mit Zöllen zu bedrohen, hat in den letzten Monaten für erhebliches Aufsehen gesorgt. Während Zölle an sich als politisches Instrument häufig eingesetzt werden, um den heimischen Markt zu schützen und Produktionsverlagerungen ins Ausland zu verhindern, stellt sich bei der pharmazeutischen Branche jedoch die Frage nach der tatsächlichen Effektivität dieser Maßnahme. Denn hinter dem Abwandern großer Pharmakonzerne in Niedrigsteuerländer wie Irland steckt primär ein steuerliches Kalkül und kein reiner Kostenfaktor in der Produktion. Die Pharmabranche ist bekannt für ihre hohen Margen, was in der Folge dazu geführt hat, dass Unternehmen komplexe Offshore-Strukturen nutzen, um Gewinne in Ländern mit niedrigem Steuersatz zu buchen. Für viele pharmazeutische Unternehmen lag der Hauptanreiz bei der Verlagerung also nicht etwa in geringeren Arbeitskosten, sondern im optimierten Steuermanagement.
Das Ziel war es, von zum Teil sehr niedrigen Steuersätzen, wie etwa 12,5 Prozent in Irland, zu profitieren, während die USA lange Zeit eine relativ hohe Unternehmenssteuer von bis zu 35 Prozent hatten. Dieses Ungleichgewicht macht es wirtschaftlich sinnvoll, geistiges Eigentum ins Ausland zu verlagern und Gewinne dort zu verbuchen – was wiederum den heimischen Produktionsstandort entsprechend schwächt. Dennoch hat sich durch die Steuerreform im Jahr 2017 einiges verändert. Die Reduzierung der staatlichen Unternehmenssteuer auf 21 Prozent und die Einführung einer Mindestbesteuerung für bestimmte Auslandseinnahmen verringerten die Attraktivität des bisherigen Steuerparadieses Irland. Auch Irland selbst erhöhte seinen Spitzensteuersatz auf 15 Prozent unter dem Druck internationaler Regulierungen gegen Steuervermeidung.
Diese Schritte haben dazu geführt, dass pharmazeutische Unternehmen mittlerweile mehr Anreize haben, Produktion und Gewinnbuchungen in den USA zu halten oder sogar auszuweiten. Trotz dieser Entwicklung ist es jedoch fraglich, ob Strafzölle auf pharmazeutische Produkte das gewünschte Ziel – nämlich die Rückholung der Produktion in die USA – nachhaltig erreichen können. Die Pharmaindustrie unterscheidet sich grundlegend von Branchen wie Bekleidung oder Elektronik, bei denen die Arbeitskosten einen dominanten Faktor darstellen. Für hochwertige Arzneimittel und komplexe Impfstoffe besteht ein großer Bedarf an spezialisierten Produktionsanlagen und hochqualifizierten Arbeitskräften, wie sie vor allem in den USA und Europa zu finden sind. Die Herstellung von Wirkstoffen an sich erfolgt zwar häufig im Ausland, doch die komplexe Endfertigung und Markteinführung hochpreisiger Arzneimittel bleiben oft in den USA.
Ein Fingerzeig, dass simple Zölle auf die Rohstoffimporte alleine noch keine dauerhafte Lösung darstellen. Stattdessen liegt der Schlüssel zu einer nachhaltigen Stärkung der heimischen Pharmaindustrie vor allem in der Anpassung der steuerlichen Rahmenbedingungen. CEO David Ricks von Eli Lilly brachte es auf den Punkt, indem er auf die Notwendigkeit hinwies, die steuerpolitischen Unterschiede zu verringern, anstatt ausschließlich auf Zölle zu setzen. Auch Führungskräfte von Pfizer, Johnson & Johnson und Merck sprechen sich öffentlich für weitere Steuerreformen aus, die die Wettbewerbsfähigkeit der USA fördern. Neben der Höhe der Unternehmenssteuer sind dabei auch Regelungen zur Besteuerung internationaler Umsätze und zur Behandlung geistigen Eigentums von zentraler Bedeutung.
Diese steuerlichen Anpassungen könnten dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Gewinnverlagerungen ins Ausland nicht mehr so stark forcieren müssen, sondern stattdessen vermehrt in den heimischen Markt investieren. Die politischen Maßnahmen von Präsident Trump, die Pharmaindustrie mit Zöllen zu belegen, sendeten zwar ein deutliches Signal und brachten einige Firmen dazu, ihre Importe zu verringern und bestehende Produktionskapazitäten in den USA zu erweitern. Doch die bloße Erhebung von Strafzöllen könnte auch negative Konsequenzen haben, darunter steigende Kosten für Arzneimittel, die viele Verbraucher tragen müssten. Zudem ist die Pharmaindustrie eng verflochten mit globalen Lieferketten, wodurch eine reine Fokussierung auf Zölle die komplexen Zusammenhänge wenig abbildet. Außerdem ist der globale Wettbewerb in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung intensiv.
Um in diesem Umfeld weltweit erfolgreich zu sein, sind internationale Kooperationen und Produktionsnetzwerke essenziell. Es wäre daher kontraproduktiv, rein protektionistische Maßnahmen in den Vordergrund zu stellen. Die Modernisierung des Steuersystems und harmonischere steuerliche Rahmenbedingungen könnten dagegen Anreize schaffen, dass Unternehmen sich stärker auf heimische Investitionen konzentrieren, ohne dabei die globalen Chancen und Netzwerke aus den Augen zu verlieren. Zudem unterstützt ein attraktives Steuersystem nicht nur die Pharmakonzerne selbst, sondern wirkt insgesamt innovationsfördernd und schafft zusätzliche Arbeitsplätze in Forschung und Produktion. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt auch, dass Zölle kurzfristig und symbolisch wirken können, während Steuerpolitiken langfristigen Einfluss auf Standortentscheidungen und Investitionen nehmen.
Die USA verfügen noch immer über eine starke Basis in der pharmazeutischen Fertigung, insbesondere bei High-Value-Produkten und komplexen Arzneiformen wie Injektionslösungen. Durch gezielte Steueranpassungen könnte dieses Potenzial ausgebaut und der Importdruck verringert werden. Abschließend verdeutlichen die Entwicklungen der letzten Jahre, dass Steuerpolitik ein wesentliches Instrument darstellt, um die Rückkehr der Pharmaindustrie in die USA zu fördern. Während Tarifdrohungen politischen Druck erzeugen und Aufmerksamkeit schaffen, ist der Weg zu einer nachhaltigen Stärkung der heimischen Pharmafertigung vor allem über eine Reform des Steuersystems zu führen. Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Beschäftigung profitieren unmittelbar von einem Umfeld, das steuerliche Hindernisse absenkt und Anreize für inländische Produktion setzt.
Diese Erkenntnisse liefern wichtige Impulse für die Diskussionen in Politik und Wirtschaft, die in den kommenden Jahren maßgeblich bestimmen, wie die globale Pharmaindustrie positioniert und auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet wird.