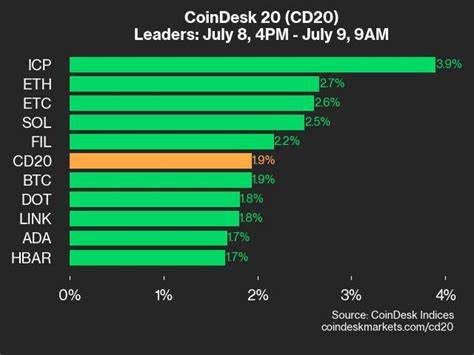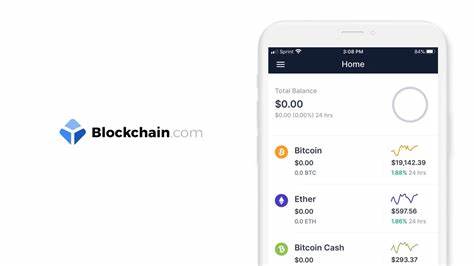Das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, steht seit einigen Jahren vermehrt im Mittelpunkt öffentlicher und wissenschaftlicher Diskussionen – nicht zuletzt, weil neurodivergente Personen zunehmend ihre Stimmen erheben und ihre Erfahrungen teilen. Besonders in anspruchsvollen Berufen wie der Forschung und Wissenschaft, in denen hohe Konzentration und strukturierte Denkprozesse essenziell sind, wirkt ADHS oft als zweischneidiges Schwert. Doch Wissenschaftler mit ADHS beweisen, dass sich Herausforderungen und besondere Fähigkeiten verbinden lassen, um im akademischen Alltag erfolgreich zu sein. Die Diagnose ADHS bei erwachsenen Wissenschaftlern ist vielfach ein Schlüsselmoment, der neue Selbstverständniswege eröffnet. Forscherinnen und Forscher wie die Vulkanologin Lis Gallant geben Einblicke in ihre Erlebnisse.
Während ihrer Promotion wurde ihr erstmals bewusst, dass die Art und Weise, wie sie arbeitet – sehr detailliert und fokussiert in mündlichen Präsentationen, gleichzeitig aber mit Schwierigkeiten bei längeren schriftlichen Ausarbeitungen – durch ADHS beeinflusst ist. Dieser Balanceakt zwischen begeisternder Energie und der Herausforderung, lange Projekte zu strukturieren, spiegelt viele Erfahrungen von Wissenschaftlern mit ADHS wider. Die neurodivergente Wahrnehmung und Denkweise bringen oft besondere kreative Kräfte mit sich. Während manche Betroffene im wissenschaftlichen Alltag Schwierigkeiten mit Zeitmanagement, Organisation oder der Fokussierung über lange Zeitspannen haben, ermöglichen ihnen ihre intensiven Interessen und ihre Begeisterung oftmals außergewöhnliche Momente der Konzentration. Wissenschaftler berichten von sogenannten "Hyperfokusphasen", in denen sie mit bemerkenswerter Produktivität komplexe Probleme lösen.
Diese Phasen sind aber nicht immer leicht vorhersehbar oder mit herkömmlichen Arbeitsstandards vereinbar, weshalb die Strukturierung des Arbeitsalltags und die Entwicklung individueller Strategien eine große Rolle spielen. Ein wichtiges Thema ist die Selbstakzeptanz und der Umgang mit der eigenen neurodivergenten Identität in der traditionell sehr normierten Forschungswelt. Viele Wissenschaftler berichten, dass sie lange Zeit vergeblich versucht haben, ihre Arbeitsweise den üblichen akademischen Erwartungen anzupassen, was zu Frustrationen und Überforderung führte. Erst die Anerkennung der eigenen Bedürfnisse und Grenzen öffnete Raum für produktive Arbeitsmethoden und besseres Wohlbefinden. Dabei können flexible Arbeitsmodelle, wie etwa die Möglichkeit zum Homeoffice oder individuell angepasste Deadlines, entscheidende Unterstützung bieten.
Darüber hinaus werden zunehmend Netzwerke und Communitys für Neurodivergente in der Wissenschaft gegründet, die Austausch, Beratung und gegenseitige Unterstützung bieten. Solche Initiativen sensibilisieren für die Vielfalt neurologischer Bedingungen und fördern inklusive Praktiken in akademischen Institutionen. Zugleich werden immer mehr Führungskräfte und Kolleginnen und Kollegen dazu angeregt, Barrieren abzubauen und neurodivergente Talente nicht nur zu erkennen, sondern gezielt zu fördern. Ein weiterer Aspekt sind die individuellen Werkzeuge und Techniken, mit denen Wissenschaftler mit ADHS ihre Konzentration steigern und ihre Produktivität optimieren. Dabei spielen Zeitplanungshilfen, digitale Reminder, strukturierte Pausen und das bewusste Setzen von Prioritäten eine große Rolle.
Zudem greifen viele auf kreative Methoden zurück, um ihre Gedanken zu ordnen, darunter Mindmaps, visuelle Notizen oder das Arbeiten in kurzen, intensiven Einheiten. Auch die bewusste Pflege von Erholungsphasen, ausreichendem Schlaf und einem gesundheitsbewussten Lebensstil trägt maßgeblich dazu bei, die Balance zwischen Energie und Erschöpfung zu finden. Im Bereich der Wissenschaft ist die Offenheit gegenüber neurodivergenten Bedürfnissen nicht nur eine Frage der individuellen Förderung, sondern ein kultureller Wandel. Die besondere Denkweise von Menschen mit ADHS kann innovative Forschungsansätze und alternative Problemlösungen hervorbringen, die der gesamten Wissenschaftsgemeinde zugutekommen. Inklusivität bedeutet daher nicht nur Zugänglichkeit, sondern auch das wertschätzende Einbinden vielfältiger Talente in den Fortschritt von Wissenschaft und Gesellschaft.
Die Geschichten von Wissenschaftlern mit ADHS zeigen, dass das scheinbare Spannungsfeld zwischen Feuer – der oft impulshaft übersprudelnden Energie – und Fokus – der tiefen, intensiven Konzentration – kein Widerspruch sein muss. Vielmehr kann es eine Quelle von Kreativität, Leidenschaft und außergewöhnlichen Leistungen sein. Entscheidend ist, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Es bleibt somit wichtig, ADHS in der Wissenschaft nicht nur als Herausforderung zu sehen, sondern als Chance, die individuellen Stärken neurodivergenter Forschender anzuerkennen und gezielt zu fördern. Die fortschreitende Sensibilisierung, Öffnung und individuelle Unterstützung bilden dafür die Grundlage.
Wissenschaft lebt von der Vielfalt ihrer Köpfe. Wenn Feuer auf Fokus trifft, können daraus einzigartige Erfolge entstehen – zum Wohle der gesamten Gesellschaft.