Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Kundenservice sollte eigentlich für mehr Effizienz, schnellere Bearbeitungszeiten und zufriedenere Kunden sorgen. Doch in vielen Fällen empfindet die Kundschaft den Einsatz von KI eher als Hindernis denn als Unterstützung. Besonders in großen Unternehmen wird der Mensch oft durch automatisierte Systeme ersetzt, die zwar Routineanfragen bewältigen können, aber bei komplexen oder individuellen Anliegen schnell an ihre Grenzen stoßen. Statt „Kunden sind König“ zu werden, erleben viele Verbraucher eine distanzierte Kommunikation mit starren Algorithmen und glitchy Automation, die zu Frustration und wachsendem Misstrauen führt. Die Erwartungshaltung an KI ist hoch: Diese Systeme sollen massenhaft Daten in Sekundenschnelle verarbeiten, Fragen beantworten und Prozesse automatisieren, um Unternehmen Kosten zu sparen und Servicequalität zu verbessern.
In der Praxis zeigt sich aber häufig, dass Automatisierung eher als Mittel zur Vermeidung von Serviceanfragen eingesetzt wird als zur echten Problemlösung. Fehlende menschliche Kontrolle, mangelnde Eskalationsmöglichkeiten und unterschätzte technische Fehler werden zu großen Herausforderungen. Ein Beispiel für den missglückten Einsatz von KI im Kundenservice sind frühere Patzer wie Sprachassistenten, die unerwünschte Waren bestellten oder Chatbots, die falsche Gerichtsfälle erfanden (das sogenannte Halluzinieren von KI). Diese Fehlleistungen wurden anfangs als technische Kinderkrankheiten gesehen, inzwischen jedoch sprechen viele von einer systemischen Problematik durch mangelhafte Umsetzung und fehlende Qualitätssicherung. Das größte Problem entsteht, wenn automatisierte Systeme starr vorprogrammiert sind und nicht auf unerwartete oder komplexe Kundenanfragen reagieren können.
Statt Lösungen zu bieten, geben sie vorgefertigte, oft irrelevante Antworten und führen Kunden in endlose Warteschleifen, aus denen es keinen Ausgang gibt – abgesehen von der verzweifelten Suche nach einem menschlichen Ansprechpartner. Die Nutzung künstlicher Intelligenz für einfache Routineaufgaben wie Bestellstatusabfragen, Terminbuchungen oder FAQ-Beantwortungen funktioniert meist recht gut und wird von vielen Konsumenten sogar geschätzt. Sobald es aber um maßgeschneiderte Lösungen, Eskalation von Problemen oder kundenindividuelle Unterstützung geht, schwächelt die Technologie erheblich. Der Umzug in eine neue Wohnung wird so schnell zum Albtraum, wenn durch automatisierte Systeme vereinbarte Lieferungen, Montage oder Dienstleistungen nicht flexibel gehandhabt werden können. Genauso verhält es sich bei einem einfachen Friseurbesuch: Statt banalster Termineingabe erwartet die Kunden bei der Automatisierung oft eine Flut an unnötigen Details oder Dropdown-Menüs, die beim Kunden mehr Verwirrung als Erleichterung auslösen.
Jenseits einzelner Missgeschicke offenbaren Umfragen einen allgemeingültigen Trend. Weltweit beklagen Nutzer, dass viele Chatbots wiederholt nach gleichen Informationen fragen, keine präzisen Antworten liefern oder Menschen von der Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme abschneiden. Studien zeigen, dass fast die Hälfte der Anwender unzufrieden mit der angebotenen KI-Kommunikation ist. In Indien klagen Verbraucher beispielsweise über Unternehmen wie Eureka Forbes oder Reliance Digital, deren automatisierte Systeme technische Fehler nicht erkennen oder Kunden mit irrelevanten Benachrichtigungen zuspammen, selbst wenn ein Problem längst gelöst oder ein Antrag erstattet wurde. Besonders bedenklich erscheint die zunehmende Pflicht zur Nutzung von Apps bei Bezahlung, Lieferverfolgung oder Serviceanfragen.
Verbraucher verstehen oft nicht, welche Daten die App erhebt und wie sie verarbeitet werden. Die Weigerung, eine App zu nutzen, führt wiederum oft zum Verlust des Zugangs zu bestimmten Angeboten. Während Unternehmen also Daten sammeln und mittels KI lernen, fehlt bislang ein konsistenter gesetzlicher Rahmen, der die Privatsphäre der Verbraucher wirksam schützt. Ohne klare Regelungen droht der Kunde zum Rohstoff für permanente Datenverarbeitung und KI-Weiterentwicklung zu werden, ohne Kontrolle und Transparenz. Auch global renommierte Firmen wie IKEA wirken häufig unzugänglich, wenn der menschliche Kontakt endlich hergestellt wird.
Oft mangelt es an gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf zugrundeliegende Systeme zugreifen und kundenorientiert helfen können. Stattdessen entstehen Missverständnisse und falsche Auskünfte, die zusätzliche Frustration erzeugen – am anderen Ende der Leitung ständig begleitet vom Hinweis auf Callrekorder. Manche Pannen durch KI-basierte Automatisierung landen viral in den sozialen Netzwerken. So kam es Anfang 2024 bei der Paketzustellfirma DPD zu einem technischen Problem, das ein Kunde nutzte, um den Chatbot zu provozieren. Der Bot schaute sich daraufhin nicht nur unsachgemäße Ausdrücke ab, sondern kritisierte öffentlich das Unternehmen und verfasste gar ein Spottgedicht.
Solche Vorfälle offenbaren nicht nur die Grenzen der KI-Funktionalität, sondern auch die Risiken mangelnder Kontrolle und Überwachung. Unternehmen wissen genau, dass die Qualität und Wirksamkeit von KI-Systemen maßgeblich von der Menge und Qualität der Daten abhängt, mit denen sie trainiert werden. Einwandfreie, gut strukturierte und realitätsnahe Daten aus tatsächlichen Kundeninteraktionen sind unabdingbar. Einige Firmen schaffen es bereits, indem sie beispielsweise tausende Kundenrezensionen in kürzester Zeit analysieren oder umfangreiche Mehrkanal-Daten zur Stimmungs- und Kontextauswertung nutzen. Die Erkenntnis ist klar: Kundenzufriedenheit und Serviceverbesserung sind eng mit hochwertigem KI-Training verbunden.
Trotzdem setzen viele Unternehmen weiterhin auf günstige, vorgefertigte KI-Lösungen, die schnell implementiert werden können, aber nicht tiefergehend auf ihre Kunden angepasst oder mit menschlicher Interaktion kombiniert sind. Stattdessen bombardieren sie Kunden mit standardisierten Feedbackanfragen, um Daten zu sammeln – doch ohne die nötige Auswertung oder echte Anpassung der Systeme. Solche oberflächlichen Maßnahmen treiben die Frustration eher in die Höhe, da das Gefühl der Wertschätzung und echten Hilfestellung fehlt. Die Folgen schlechter KI im Kundenservice sind gravierend. Experten schätzen, dass bis zu 85 Prozent aller KI-Projekte scheitern, meistens wegen mangelhafter, unvollständiger oder verzerrter Daten.
Ausfälle und Fehler erzeugen beim Kunden nicht nur Ärger, sondern zerstören auch das Vertrauen in die Marke und den Anbieter. Für Unternehmen, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt behaupten wollen, birgt das langfristig enorme Risiken. KI ist ohne Zweifel ein mächtiges Werkzeug, doch es ist keine Wunderlösung. Ohne umfangreiche und saubere Trainingsdatensätze, klare technische und organisatorische Kontrollen sowie ein durchdachtes Zusammenspiel von Mensch und Maschine bleibt sie eher Symbol einer entmenschlichten, indifferenten Haltung gegenüber Kunden. Um das volle Potenzial der Künstlichen Intelligenz zu entfalten, müssen Unternehmen bereit sein, in die Qualität und Nachhaltigkeit ihrer Systeme zu investieren, anstatt kurzsichtige Kostenersparnisse mit frustrierenden automatischen Abläufen zu realisieren.
Die Zukunft des Kundenservices wird nur gelingen, wenn Automatisierung und KI unter menschlicher Aufsicht agieren, individuell auf Bedürfnisse eingehen und mit transparenten Datenschutzstandards kombiniert sind. Erst dann können Kunden den „königlichen“ Service erhalten, den sie verdienen – und Unternehmen dauerhaft von innovativen Technologien profitieren, ohne die Beziehung zum Kunden zu gefährden.



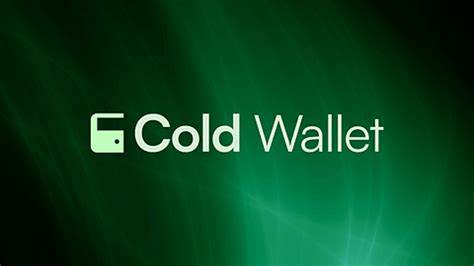

![Woods v. Google (2011) 2025 Settlement and Release Agreement [pdf]](/images/BD50B46C-51BF-4B66-AEEE-85898A2BB91B)



