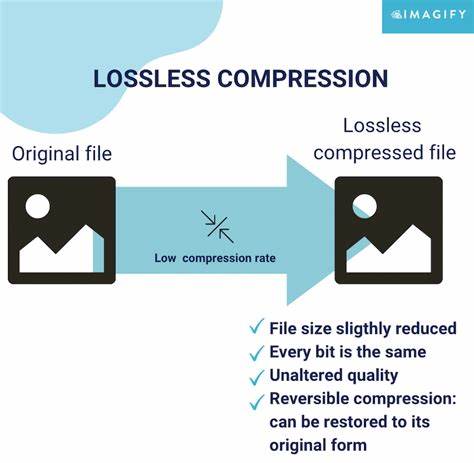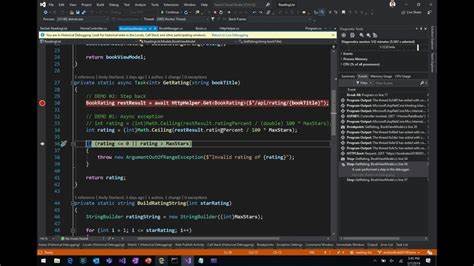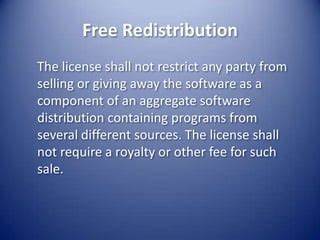In den letzten Jahrzehnten hat die Menschheit immer weiter ihren Einflussbereich ins All ausgedehnt. Während die Erforschung des Weltraums meist mit großen Pionierarbeiten in der Raumfahrt und Astronomie assoziiert wird, rückt nun ein ganz neues Forschungsfeld in den Fokus: die Aquakultur auf dem Mond. Die Idee mag auf den ersten Blick futuristisch oder gar skurril erscheinen, doch das Projekt Lunar Hatch zeigt, dass Fischzucht im Weltraum keineswegs mehr nur Science-Fiction ist. Insbesondere die Haltung und Zucht von Seebarsch als Lebensmittelquelle könnte bald Realität werden – und das mit enormen Auswirkungen sowohl für die Mars- und Mondmissionen als auch für nachhaltige Ernährungsstrategien auf der Erde. Die Bedeutung von Fisch als Nahrungsquelle im All ist unbestritten.
Fisch liefert hochwertiges Protein, das der menschliche Körper leicht verwerten kann, und enthält zudem wertvolle Omega-3-Fettsäuren sowie B-Vitamine – essenzielle Nährstoffe, die für die Gesundheit und Muskelmasse von Astronauten im mikrogravitationsarmen Umfeld des Alls besonders wichtig sind. Dr. Cyrille Przybyla, Meeresbiologe am französischen Nationalinstitut für Ozeanforschung, ist eine treibende Kraft hinter dem Lunar Hatch Projekt. Er erklärt, dass die zentrale Herausforderung darin bestehe, wie auf entfernten Raumstationen oder Mondbasen ausreichend und nachhaltig Nahrung produziert werden könne. Die Antwort liegt in der Autonomie und Kreislaufwirtschaft: Fischzucht auf dem Mond muss autark funktionieren und ohne externe Ressourcen auskommen.
Das Projekt verfolgt deshalb das Ziel, ein vollständig geschlossenes Ökosystem zu entwickeln. Hierbei werden Seebarsche in Tanks gehalten, deren Abfallprodukte zur Nährstoffquelle für Mikroalgen werden. Diese Algen wiederum füttern andere Organismen wie Muscheln oder Zooplankton, die als zusätzliche Nahrungsquelle dienen könnten. Selbst der Kot der Fische wird in diesem Kreislauf nicht verschwendet: Garnelen und Würmer wandeln ihn in Futter für die Fische um. Auf diese Weise entsteht eine nachhaltige und ausfallsichere Lebensmittelproduktion, die den Bedürfnissen einer mehrmonatigen Mission gerecht wird.
Die wissenschaftliche Herausforderung ist enorm, da die Lebensbedingungen im Weltraum extrem sind. Schon der Start der Rakete führt zu hohen Vibrationen und Beschleunigungen, die auf die empfindlichen Fischembryonen wirken. Die Lunar Hatch Wissenschaftler führten umfangreiche Tests am Boden durch, bei denen Fischlarven verschiedenen Belastungen wie Vibration, Schwerkraftänderungen und kosmischer Strahlung ausgesetzt wurden. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Seebarsch-Eier überstehen die Strapazen unbeschadet und entwickeln sich normal weiter. Damit hat sich die erste Voraussetzung für Experimente auf der Internationalen Raumstation und kommenden Mondmissionen erfüllt.
Ein weiterer Schritt zum Meilenstein der Fischzucht im All ist die tatsächlich bevorstehende Reise der befruchteten Seebarscheier ins All. Die Eier sollen während des Flugs zur ISS schlüpfen und dort unter Beobachtung gehalten werden, bevor sie eingefroren und zurück zur Erde transportiert werden. Diese Mission soll nicht nur die Machbarkeit demonstrieren, sondern auch sämtliche biologischen Auswirkungen des Allaufenthalts auf die Entwicklung der Fische dokumentieren. Zugleich wird eine Vergleichsgruppe von Seebarschen auf der Erde gepflegt, um Unterschiede genau analysieren zu können. Neben Frankreich und der European Space Agency (ESA) forschen auch andere Weltraumnationen verstärkt an geschlossenen Aquakultursystemen.
So arbeitet China an ähnlichen Konzepten auf ihrer Raumstation Tiangong. Der Wettlauf um die effizienteste und belastbarste Ernährungslösung für künftige Weltraumbasen ist entbrannt und zeigt, wie wichtig solch innovative Natursysteme für interplanetare Forschung sind. Doch Lunar Hatch ist nicht nur für die Raumfahrt von Interesse. Die zirkulären Aquakultursysteme, die für den Mond entwickelt werden, können auch auf der Erde bahnbrechende Bedeutung erlangen. Insbesondere in abgelegenen Regionen oder isolierten Gemeinden, in denen die Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln begrenzt ist, könnten solche Recycling-Kreisläufe eine nachhaltige Alternative bieten.
Die Vermeidung von Umweltverschmutzung, die effiziente Nutzung von Ressourcen und der geringe Platzbedarf solcher Anlagen sind wichtige Vorteile, die auch terrestrische Fischzucht revolutionieren könnten. Die Entwicklung von Fischzucht auf dem Mond widerspiegelt damit einen spannenden Fortschritt nicht nur in der Raumfahrttechnologie, sondern auch in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion und Umweltforschung. Das Lunar Hatch Projekt zeigt, wie Wissenschaftler interdisziplinär zusammenarbeiten, um hochkomplexe ökologische Systeme unter extremen Bedingungen zu etablieren und damit die Lebensgrundlagen zukünftiger Raumreisender zu sichern. Die Seebarsche, die heute noch in einem Laborbecken in Südfrankreich schwimmen, könnten schon bald Pioniere einer völlig neuen Ära von Weltraumernährung sein. Die Vision, dass Astronauten den Mond nicht nur erforschen, sondern dort auch leben und arbeiten, rückt mit Projekten wie Lunar Hatch immer näher.
Eine autarke Versorgung mit frischen Proteinquellen wird entscheidend sein für längere Missionen, Planetenerkundungen und die dauerhafte Präsenz des Menschen im All. Die Kombination aus moderner Aquakultur, Biotechnologie und Weltraumforschung macht deutlich, dass neuartige Ernährungskonzepte nicht nur auf der Erde, sondern auch im All das Überleben sichern und verbessern können. Noch steht Lunar Hatch vor Herausforderungen: Die Pläne für die Weltraummission sind konkret, doch ein Starttermin hängt von verfügbaren Transportmöglichkeiten bei Weltraumagenturen wie CNES und NASA ab. Die Durchführung wissenschaftlicher Experimente im All ist kosten- und logistikintensiv, doch bei positivem Verlauf könnten weitere Schritte folgen. Dazu gehören etwa vollständig funktionierende Fischzuchtanlagen auf der Mondoberfläche und Forschungen zur weiteren Integration mit pflanzlicher Nahrungsmittelerzeugung und Wasseraufbereitungssystemen.
Die Entwicklung der Aquakultur im All ist ein faszinierender Beleg, wie enge Verknüpfungen zwischen Raumfahrt und Umweltwissenschaften neue Lösungen für globale Herausforderungen liefern können. Indem Wissenschaftler unsere Unterstützung der natürlichen Kreisläufe im Mini-Ökosystem des Weltraums testen, schaffen sie auch wichtige Erkenntnisse für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen auf unserem Heimatplaneten. Die Zukunft der Ernährung könnte also tatsächlich im Weltall beginnen – mit zarten Seebarschen, die bald vielleicht schon im mondhellen Wasser schwimmen.