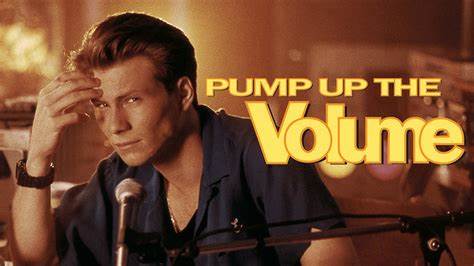In der heutigen Arbeitswelt ist es beinahe normal geworden, den Beruf nicht nur als Mittel zum Zweck zu verstehen, sondern als eine Berufung, als Ausdruck der eigenen Identität und als Quelle persönlicher Erfüllung. Diese intensiven Erwartungen an die Arbeit gehen über die klassischen Anforderungen einer guten Bezahlung oder eines sicheren Arbeitsplatzes hinaus. Sie verlangen von uns, unsere Persönlichkeit in den Job einzubringen, uns damit zu identifizieren und in der Arbeit kontinuierlich zu wachsen. Doch diese Idealisierung der Arbeit und das Erwartungskorsett, das daraus entsteht, sind nicht einfach Zufälle moderner Zeit. Sie wurzeln tief in der Geschichte der amerikanischen Arbeitskultur und im Zusammenspiel von Psychologie, Wirtschaft und gesellschaftlichen Umbrüchen.
Erik Bakers Buch „Make Your Own Job: How the Entrepreneurial Work Ethic Exhausted America“ beleuchtet diese Entwicklung umfassend und kritsch. Er zeigt auf, wie die Verschmelzung von positivem Denken und Unternehmergeist einen Kult der Arbeit hervorgebracht hat, der auf einer Illusion basiert und letztlich mehr zerstört als aufbaut. Der Ursprung dieses Arbeitskults findet sich bereits im 19. Jahrhundert. Die Bewegung der sogenannten „New Thought“ entstand als spirituelle Reaktion auf die Unsicherheiten des kapitalistischen Wirtschaftsbooms in den USA.
Die Autoren dieser Bewegung, zu denen etwa Ralph Waldo Trine gehörte, vertreten die Vorstellung, dass Gedanken eine schöpferische Kraft besitzen und dass jeder Mensch durch die richtige geistige Einstellung in der Lage ist, das eigene Schicksal selbst zu formen. Selbst in widrigen Umständen – sei es Armut oder Berufslosigkeit – kann man durch positive Gedanken und die richtige innere Haltung Glück und beruflichen Erfolg manifestieren. Diese Idee fand auf ungewöhnliche Weise Anhänger: Selbst prominente Industrielle wie Henry Ford schätzten die Schriften von New Thought-Autoren. Die Idee, dass Arbeit ein Akt der Selbstverwirklichung und eine spirituelle Aufgabe sei, wurde später durch die amerikanische Psychologie weiterverbreitet und mit wirtschaftlichem Denken verschmolzen. Bekannte Persönlichkeiten wie Abraham Maslow und Martin Seligman verbanden psychologische Konzepte wie Selbstverwirklichung, „Flow“ und eine wachstumsorientierte Denkweise mit dem Unternehmertum.
Für sie war der Unternehmer der Archetypus des erfüllten Menschen, der durch seine Innovationskraft nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern persönliches Glück erreicht. Dabei wurde die Psychologie selbst zum Sprachrohr einer ökonomischen Ideologie, die nicht nur Leistungsbereitschaft förderte, sondern auch die Bereitschaft, sich selbst für den Erfolg maximal zu vermarkten. Unternehmerisches Denken wurde zum Maßstab – nicht nur für Gründer, sondern für alle Beschäftigten. Dieses Denkmodell bringt jedoch große Gefahren mit sich. Es suggeriert, dass das „sich-selbst-Verkaufen“ und das Ausrichten der eigenen Persönlichkeit auf Erfolg nicht nur sinnvoll, sondern notwendig sei.
Fühlt man sich vom Job entfremdet oder gelingt der ersehnte Erfolg nicht, so wird das schnell als persönliches Versagen interpretiert. Diese Sichtweise ignoriert die ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die den Handlungsspielraum individueller Arbeitnehmer stark begrenzen. Die Arbeit wird so zu einer existenziellen Quelle von Selbstwert, während Sicherheit, faire Entlohnung und soziale Absicherung an Bedeutung verlieren. Erik Baker beschreibt diese Entwicklung als eine Art Fetisch, der Arbeit zu einem Gott erhebt und uns dazu anspornt, uns über unsere Jobs zu definieren. Die negativen Folgen sind Burnout, psychische Erschöpfung und ein Gefühl der Leere, wenn die Arbeit einmal wegfällt oder uns nichts mehr gibt.
Ein tragisches Beispiel hierfür ist der Unternehmer Tony Hsieh, der mit seinem Buch „Delivering Happiness“ den Mythos vom erfüllenden Unternehmertum popularisierte, jedoch selbst einem inneren Druck erlag, der in seinem frühen Tod mündete. Die Verbindung von Selbsthilfe, positiver Psychologie und Unternehmensethik ist kein modernes Phänomen, sondern hat historische Vorläufer, die bis in die Zwischenkriegszeit und die Weltwirtschaftskrise zurückreichen. Bestsellerautoren wie Napoleon Hill und Dale Carnegie, die damals das Selbsthilfegenre dominierten, propagierten Vorstellung einer selbst gestaltbaren Wirklichkeit, in der persönlicher Erfolg eine Frage von Haltung und Imagination sei. Viele dieser Figuren lebten jedoch selbst in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen oder waren in zweifelhafte Geschäfte verstrickt, was ihren optimistischen Botschaften eine zweifelhafte Authentizität einräumt. Der Kult des Unternehmertums wurde auch durch charismatische Führungspersönlichkeiten aus Deutschland beeinflusst.
Max Weber prägte mit seinem Konzept der protestantischen Arbeitsethik den Begriff der „Arbeitsfreude“ als eine moralische Pflicht und ein Zeichen von Gottgefälligkeit. Joseph Schumpeter erweiterte diese Ideen um das Konzept der „schöpferischen Zerstörung“, in der Unternehmer als dynamische Kräfte dargestellt werden, die durch Innovation nicht nur Unternehmen, sondern ganze Märkte umgestalten. Obgleich diese Theorien wichtige Erkenntnisse geliefert haben, warnt Baker vor ihren dunklen Seiten: Unternehmerische Helden wurden oft zu überhöhten Gestalten mit fast schon faschistischen Zügen, die rücksichtslos über Normen und soziale Schranken hinwegsetzten. Steve Jobs wurde als Paradebeispiel einer solchen charismatischen Führerfigur beschrieben, deren Unternehmenskultur einer Sekte ähnelte und in deren Schatten die Ausbeutung von Arbeitskräften möglich wurde. Die Verschmelzung von Psychologie und Unternehmertum fand in den amerikanischen Business Schools ihre Vollendung.
Wesentliche Elemente der positiven Psychologie – „Grit“, „Flow“ und die sogenannte „Growth Mindset“ – wurden zu Tools, mit denen Arbeitnehmer zwar motiviert, aber auch stärker ausgebeutet werden. Wenn Menschen verpflichtet sind, sich selbst als Marke zu sehen und ihre Identität mit dem Unternehmen verschmelzen zu lassen, wird der Druck zur Selbstausbeutung nahezu allgegenwärtig. So kann ein Arbeitnehmer nicht mehr einfach seine Arbeitszeit ableisten, sondern muss sich stetig aktiv entwickeln und beweisen. Diese Entwicklung führte zur Entstehung einer toxischen Arbeitskultur, die von „Hustle“ und permanenter Selbstoptimierung geprägt ist. Burnout ist die häufige Folge, da die Grenze zwischen Arbeit und Leben immer mehr verschwimmt.
Gleichzeitig bleibt aber ein gesellschaftlicher Mangel bestehen: Deindustrialisierung und der Wandel der Arbeitsmärkte führen dazu, dass immer mehr Menschen Arbeitslosigkeit oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse ausgesetzt sind. Die Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg und dem Verlust der eigenen Rolle im Beruf verstärkt das Bedürfnis nach Unternehmergeist und positiver Selbstvermarktung nur noch mehr und erzeugt somit eine Art Teufelskreis. Ein weiterer Aspekt dieser Kultur ist, dass der unternehmerische Geist oft dazu dient, staatliche Schutzmechanismen und soziale Sicherungen infrage zu stellen. Die Vorstellung, dass der Markt und der einzelne Unternehmer alles regeln können, geht einher mit Deregulierungen und einem Rückzug des Staates aus dem sozialen Bereich. So entstehen oftmals paradox erscheinende Allianzen zwischen Tech-Milliardären und Gig-Arbeitern, die beide scheinbar gegen behördliche Eingriffe kämpfen, obwohl ihre Interessen auf unterschiedlichen Ebenen liegen.
Die Gig-Arbeiter, denen oftmals Benefits oder Gewerkschaftsrechte fehlen, werden so zu einem Symbol für Freiheit stilisiert, während die ökonomische Realität ihre prekäre Lage eher verschärft. Das Dilemma unserer Zeit besteht darin, dass die Sehnsucht nach sinnerfüllter Arbeit und nach Autonomie verständlich und legitim ist. Jeder Mensch möchte sinnvoll sein Tun erfahren und sich mit seinem Beruf identifizieren können. Doch aus dieser Sehnsucht ist ein System entstanden, das Kontrolle und Ausbeutung leichter macht, indem es individuelle Verantwortung überhöht und strukturelle Probleme unsichtbar macht. Die Unternehmerethik, die verspricht, jeder könne es schaffen, wer nur richtig an sich arbeite, wird somit zu einer subtilen Ideologie, die soziale Ungleichheit legitimiert und die Autonomie der Einzelnen infrage stellt.
Es stellt sich die Frage, wie wir in Zukunft mit diesem Kult des Unternehmertums umgehen können. Eine erste Antwort könnte darin liegen, die Psychologisierung der Arbeit kritisch zu hinterfragen und den Fokus stärker auf kollektive und soziale Lösungen zu legen. Soziale Sicherungssysteme, Gewerkschaften und Solidarität könnten wieder mehr in den Vordergrund rücken, um zu verhindern, dass Menschen allein für ihr Überleben und ihre Selbstverwirklichung verantwortlich gemacht werden. Dabei ist es wichtig, den Wert von Arbeit und Anerkennung zu erhalten, ohne jedoch Arbeitswahn und Selbstausbeutung zu fördern. Gleichzeitig darf die Idee der sinnerfüllten Arbeit nicht verworfen werden.
Sie kann eine Quelle echter Motivation und Zufriedenheit sein, wenn sie im richtigen Kontext steht und nicht als trojanisches Pferd zur Ausschöpfung maximaler Leistung dient. Unternehmen und Gesellschaften stehen vor der Herausforderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Arbeitnehmer nicht nur funktionieren müssen, sondern wirklich aufblühen können, ohne ihre Gesundheit oder ihr Privatleben zu opfern. Dazu gehört auch ein kritischer Blick auf die Formen der Arbeit selbst, neue Arbeitsmodelle mit mehr Flexibilität sowie eine Kultur der Anerkennung jenseits von bloßer Produktivität. Der Kult des Unternehmertums ist ein Spiegel unserer Zeit – geprägt von ökonomischer Unsicherheit, dem Aufstieg der Selbsthilfe und einem tiefsitzenden Bedürfnis nach Bedeutung. Gleichzeitig offenbart er die Schattenseiten einer Arbeitskultur, die individuelle psychologische Strategien nutzt, um fundamental soziale Probleme zu überspielen.
Die Erkenntnisse von Denkern wie Erik Baker helfen uns, diese Dynamiken besser zu verstehen und neue Wege zu finden, um Arbeit wieder zu einem positiven, nachhaltigen Bestandteil unseres Lebens zu machen, ohne uns dabei zu verausgaben oder unsere Würde zu verlieren. Die Herausforderung für die Zukunft liegt darin, Arbeit wertzuschätzen und Sinn zu geben – allerdings ohne dass sie zur einzigen Quelle von Identität und Lebenssinn wird und damit ihre Ausbeutung und Überhöhung erleidet. Es geht darum, die Balance zu finden zwischen individueller Entfaltung und kollektiver Verantwortung – und die Liebe zur Arbeit nicht aus kommerziellen Interessen missbrauchen zu lassen, sondern als echte Quelle von Glück und Gemeinschaft zu bewahren.



![AI Chrome Extension Generator? [video]](/images/AF2F8BDD-E8AD-45BA-91F4-33545F8A1DFA)