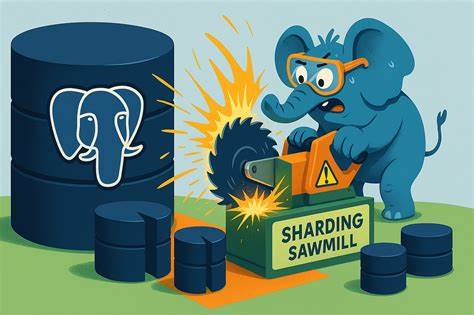In der Welt moderner Datenbanken stoßen Entwickler und Unternehmen immer wieder auf die Herausforderung, ihre Systeme zu skalieren, um den Anforderungen wachsender Datenmengen und Nutzerzahlen gerecht zu werden. PostgreSQL, eine der beliebtesten Open-Source-Datenbanken, bietet exzellente Leistung und Stabilität, doch sie ist primär für den Betrieb auf einem einzelnen Server optimiert. Wenn die Last steigt, wird oft Sharding als Lösung angepriesen, jedoch ist Sharding nicht gleichbedeutend mit einem vollständig verteilten Datenbanksystem. Dieser feine, aber entscheidende Unterschied hat weitreichende Konsequenzen für Konsistenz, Transaktionen und die Architektur von Anwendungen. PostgreSQL zeigt insbesondere dann starke Leistungen, wenn die Verfügbarkeit des Dienstes und die Haltbarkeit der Daten nicht im Vordergrund stehen.
Viele setzen auf eine sogenannte „fault-intolerante“ Konfiguration, welche zwar hohe Schreibgeschwindigkeiten ermöglicht, jedoch ohne Aktivierung von Write-Ahead Logging (WAL) und replizierter Datensicherung. Sobald jedoch WAL und eine Form von Replikation hinzugefügt werden, was notwendig ist, um Datenverlust und Ausfälle vorzubeugen, verringert sich die Performance drastisch. Dies liegt vor allem daran, dass Synchronous Replication und Write-Ahead Logging zusätzliche Latenzen und Bottlenecks verursachen. Benchmark-Ergebnisse, beispielsweise anhand des bekannten TPC-C Tests, zeigen, dass eine „fault-tolerante“ Konfiguration von PostgreSQL lediglich geringfügig schneller als moderne verteilte Datenbanken wie YDB ist, während sie gleichzeitig deutlich höhere Latenzen aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass Sharding einer Datenbankserverlandschaft automatisch deren Verteilung über mehrere Systeme und damit auch eine echte Verteilung der Daten bedeutet.
Technisch gesehen bedeutet Sharding, dass eine große Datenmenge in kleinere, handhabbare Teile aufgeteilt und auf verschiedene Serversysteme verteilt wird. Doch die einzelnen PostgreSQL-Instanzen sind dabei isoliert voneinander und kommunizieren nicht untereinander. Es existiert kein globales Koordinationssystem, das über sämtliche Shards hinweg die Daten konsistent hält. Eine spezielle Koordinationsschicht übernimmt lediglich die Aufgabe, Benutzeranfragen an die richtigen Shards weiterzuleiten. Dieses Konzept findet sich in Lösungen wie Citus, einer beliebten PostgreSQL-Erweiterung, aber auch anderen Sharding-Methoden sehen ähnlich aus.
Solange ein Benutzer- oder Anwendungstransaktion nur Daten auf einem einzelnen Shard betrifft, verhält sich das System wie eine klassische monolithische Datenbank. Sobald jedoch Anfragen mehrere Shards gleichzeitig betreffen – sogenannte Multi-Shard-Transaktionen – lassen sich die atomaren ACID-Garantien nicht mehr vollumfänglich sicherstellen. Während Atomizität vorliegt, fällt die Isolation zwischen den Shards deutlich schwächer aus als im monolithischen System. Dies bedeutet, dass Transaktionen nicht ohne Weiteres in einem konsistenten globalen Zustand „sichtbar“ werden, was zu inkonsistenten Datenzuständen in Echtzeit führen kann. Die ACID-Eigenschaften einer Transaktion sind essenziell für die Datenintegrität.
Sie umfassen Atomizität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit. Insbesondere die Isolation, die verhindert, dass parallele Transaktionen sich gegenseitig beeinflussen, wird in verteilten Systemen zur Herausforderung. Das Protokoll Two-Phase Commit (2PC), vielfach in verteilten Datenbanken verwendet, garantiert zwar Atomizität, das heißt, dass eine Transaktion entweder komplett angewendet oder komplett verworfen wird. Es bietet jedoch keine Garantie für eine gleichzeitige Sichtbarkeit (Atomic Visibility) der Änderungen über alle beteiligten Shards hinweg. Folglich können Anwendungen inkonsistente Zustände beobachten, die theoretisch gar nicht auftreten sollten.
Ein anschauliches Beispiel verdeutlicht dieses Verhalten: Angenommen, eine Datenbank speichert Kontoinformationen für zwei Konten derselben Person; Konto X und Konto Y liegen auf verschiedenen Shards. Der Benutzer überweist Geld von Konto X zu Konto Y. Dank 2PC ist sichergestellt, dass beide Buchungen entweder insgesamt erfolgreich sind oder nicht stattfinden. Während des Vorgangs kann jedoch ein anderer Nutzer den Kontostand beider Konten lesen und wegen der zeitlich versetzten Commit-Prozeduren auf den einzelnen Shards einen falschen Gesamtbetrag sehen. Dieses Phänomen offenbart sich darin, dass ohne globalen Snapshot-Mechanismus keine kohärente, atomare Sicht auf den transaktionalen Zustand gewährleistet wird.
Die Folgen dieser Eigenart werden besonders bei Lösungen wie Citus sichtbar. Citus erweitert PostgreSQL, um Sharding zu ermöglichen, bewahrt jedoch nicht die vollständigen ACID-Eigenschaften bei Multi-Shard-Transaktionen. Die Atomizität wird mit 2PC gesichert, die Isolation nicht. Damit ist klar, dass Citus nicht per se eine vollwertige verteilte Datenbank ist, sondern ein Sharding-Framework mit erweiterten Fähigkeiten. Die Entwickler von Citus geben an, dass Multi-Shard-Transaktionen mit Isolation auf dem Niveau von „Read Committed“ arbeiten, was weitaus schwächer ist als die normalerweise gewünschten „Repeatable Read“ oder „Serializable“ Isolationsebenen.
Diese Tatsache ist nicht ausreichend dokumentiert und kann Entwickler überraschen, die von ACID-Konformität ausgehen. Auch wenn der Wunsch nach maximaler Konsistenz verständlich ist, müssen Datenbankarchitekten oft Abwägungen treffen. Verteilte Transaktionen und globale Snapshot-Isolation erfordern zusätzlichen Aufwand, erweiterte Protokolle und höhere Latenzen. Die dabei entstehenden Netzwerk-Round-Trips (RTT) zur Koordination der verschiedenen Datenbankknoten verteuern und verlangsamen Abfragen. Im Vergleich dazu arbeitet PostgreSQL auf einem einzelnen Host äußerst effizient, da keine Netzwerklatenz auftritt.
Werden synchrone Replikation und 2PC hinzugefügt, kann die Zeit pro Transaktion um mehrere Millisekunden ansteigen. Praktisch lässt sich jedoch sagen, dass innerhalb eines Rechenzentrums mit schnellen Verbindungen zwischen den Servern zu vernachlässigenden Latenzen kommt. In solchen Fällen bleibt die Mehrfachrundlaufzeit im Bereich akzeptabler Werte. Die Frage bleibt, ob eine kleine Performanceverbesserung den potenziellen Verlust von Konsistenz und die erhöhte Komplexität in der Anwendungslogik rechtfertigt. Anwendungen, bei denen strikte Korrektheit zentral ist, beispielsweise im Finanzbereich, können sich diese Kompromisse kaum leisten.
Die Debatte über die Balance zwischen Konsistenz, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz – bekannt als CAP-Theorem – ist seit Jahren ein Kernpunkt in den Datenbanksystemen. Einerseits gehen manche Systeme Kompromisse bei der Konsistenz ein, um horizontale Skalierung und hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Andererseits gibt es Anwendungen, die maximale Korrektheit brauchen und daher eher auf Systeme setzen, die streng ACID-konform und mit verteilten Transaktionen arbeiten. Verteilte Datenbanksysteme wie YDB, CockroachDB oder YugabyteDB haben sich auf die Fahnen geschrieben, strenge ACID-Garantien über verteilte Knoten hinweg zu liefern, ohne dabei unzumutbare Performanceeinbußen hinzunehmen. Diese Systeme implementieren komplexe globale Snapshot-Mechanismen und optimierte Konsensprotokolle, die dafür sorgen, dass alle Knoten stets einheitliche, atomare und isolierte Sichtweisen auf die Daten haben.
Dadurch reduzieren sie die Notwendigkeit für Entwickler, inkonsistente Zwischenergebnisse in der Business-Logik abzufangen oder Systemverhalten zu „erklären“. Die Entwicklung solcher Systeme ist jedoch komplex und erfordert sorgfältige Abstimmungen zwischen Latenz, Durchsatz und Verfügbarkeit. Wenn PostgreSQL also an seine Grenzen stößt, gilt es, genau zu prüfen, ob eine Sharding-Lösung wie Citus wirklich den Anwendungsanforderungen entspricht. Nicht selten führt der Weg hin zu verteilten Datensystemen, die von Anfang an für verteilte Transaktionen und strikte Konsistenz ausgelegt sind. Dabei sollten Entwickler sich nicht von der vermeintlichen Einfachheit des Shardings blenden lassen, sondern die Bedeutung der Isolation und Konsistenz in ihrem spezifischen Anwendungskontext ernsthaft bewerten.
Auch wenn der Overhead von verteilten Transaktionen höher ist als bei shardingbasierten Ansätzen, kann die Investition in eine vollwertige verteilte Datenbank langfristig Kosten durch reduzierte Fehleranfälligkeit und vereinfachte Anwendungslogik einsparen. Innovative verteilte Datenbanken zeigen mittlerweile, dass diese Technologien keine Kopplung von Performanceverzicht und Konsistenz sein müssen. Die Entscheidung liegt also nicht allein bei der Leistungsoptimierung, sondern muss die Kriterien Zuverlässigkeit, Datenintegrität sowie Wartungsaufwand mit einbeziehen. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wahl der richtigen Datenbanktechnologie stark von den spezifischen Bedürfnissen eines Projekts abhängt. Wer hinreichend mit den Grenzen von Sharding und PostgreSQL vertraut ist, kann fundierte Entscheidungen treffen und unerwartete Probleme bei der Skalierung vermeiden.
Für Systeme, die über den Horizont eines einzelnen Postgres-Servers hinauswachsen und bei denen Datenintegrität und Konsistenz eine zentrale Rolle spielen, sind verteilte Datenbanksysteme oftmals die bessere Alternative. Das Verstehen der Unterschiede zwischen Sharding und echten verteilten Verfahren ist daher ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer robusten und skalierbaren Architektur.