Go hat seit seiner Einführung im Jahr 2009 einen bemerkenswerten Einfluss als Programmiersprache erlangt. Besonders in der Welt der Nebenläufigkeit bietet Go mit seinem Scheduler und den leichtgewichtigen Goroutinen eine sehr effiziente Lösung zur Verwaltung von parallelem Code. In der heutigen Softwareentwicklung, in der skalierbare und reaktive Systeme gefragt sind, ist es essenziell, das Scheduler-Verhalten in Go zu verstehen, um Programme performant und ressourcenschonend zu gestalten. Das Herzstück des Go-Schedulers bildet das GMP-Modell, bestehend aus den drei grundlegenden Abläufen: Goroutinen (G), Betriebssystem-Threads (M) und logischen Prozessoren (P). Das GMP-Modell ermöglicht es, tausende Goroutinen effizient zu verwalten und auf wenigen Threads auszuführen, was den Overhead traditioneller Betriebssystem-Threads deutlich reduziert.
Goroutinen sind dabei nicht einfach nur leichtgewichtige Threads, sondern abstrakte Ausführungseinheiten, die durch den Scheduler verwaltet und den Betriebssystem-Threads zugewiesen werden. Jeder Goroutine wird eine geringe initiale Größe im Stack zugewiesen, meist um die 2 Kilobyte, wodurch sich der Speicherverbrauch enorm gegenüber nativen Threads reduziert. Durch Recycling-Mechanismen kann der Scheduler Goroutinen nach deren Beendigung in einem Pool parken, um sie für zukünftige Aufgaben wiederzuverwenden. Die logischen Prozessoren (P) spielen eine entscheidende Rolle, indem sie die Verbindung zwischen Goroutinen und Betriebssystem-Threads herstellen. Die Anzahl der Prozessoren entspricht in der Regel dem Wert von GOMAXPROCS, der definiert, wie viele Goroutinen maximal gleichzeitig auf Betriebssystem-Threads in paralleler Ausführung laufen können.
Diese Struktur reduziert Speicherzugriffe und Lock-Konkurrenz drastisch, indem jedem Prozessor eine lokale Run-Queue zugeordnet ist, in der die Goroutinen gelagert werden, die dieser Prozessor ausführen soll. Sollte ein Prozessor keine Goroutinen mehr zum Ausführen haben, kann er von anderen Prozessoren Aufgaben stehlen, um eine bessere Lastverteilung und Ressourcenauslastung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu klassischen Thread-Modellen, die entweder many-to-one, one-to-one oder many-to-many sind, wählt Go einen ausgereiften many-to-many-Ansatz mit besonderen Optimierungen. Mit dem GMP-Modell kann Go mehrere Goroutinen auf mehreren Betriebssystem-Threads gleichzeitig ausführen, ohne dabei in erhöhte Komplexität zu verfallen oder Rechenressourcen ungenutzt zu lassen. Die Verwaltung der Betriebssystem-Threads (M) ist dafür verantwortlich, die eigentliche Ausführung im Kernel auszuführen und das Go-Laufzeitsystem mit den nötigen Ressourcen zu versorgen.
M kann sich mit einem logischen Prozessor P verbinden, um Goroutinen auszuführen, oder in einem Ruhezustand verbleiben, wenn keine Arbeit ansteht. Threads sind auch dafür zuständig, Signale zu verarbeiten, systemnahe Operationen durchzuführen und Systemaufrufe zu handhaben. Sehr hilfreich hierbei ist der sogenannte System-Monitor (sysmon), welcher für die Überwachung langer Ausführungen zuständig ist und zum Beispiel bei Bedarf lang laufende Goroutinen preemptiv unterbrechen kann, indem er Signale an Threads sendet. Das Scheduling von Goroutinen erfolgt überwiegend in einer Endlosschleife. Threads rufen fortlaufend eine Methode auf, die nach einer auszuführenden Goroutine sucht.
Dabei werden zunächst lokale Warteschlangen konsultiert und im Bedarfsfall Arbeit von globalen Queues oder anderen Prozessoren gestohlen. Sollte keine Goroutine verfügbar sein, wartet der Thread auf Ereignisse oder eingehende Signale, bis neue Aufgaben durch Netpoll oder Zeitgeber bereitgestellt werden. Dieser Mechanismus sorgt für eine dynamische und reaktive Nutzung von CPU-Ressourcen. Ein besonderes Augenmerk gilt der sogenannten Preemption – also der unterbrechenden Umschaltung von Goroutinen, um faire Ressourcenzuweisung sicherzustellen. In älteren Versionen von Go war dies ein kooperativer Prozess, bei dem Programmierer explizit Aufrufe tätigen mussten, um anderen Goroutinen eine Chance zu geben.
Seit Go 1.14 gibt es jedoch eine nicht-kooperative Präemption, bei der lang laufende Goroutinen durch Signale preemptiv angehalten und andere Aufgaben gestartet werden können. Dies gelingt durch den Einsatz eines Signal-Handlers, der mittels tgkill-Systemaufruf Threads gezielt ansprechen und ihren Programmzähler auf präemptive Funktionen umschalten kann. Die Behandlung von Systemaufrufen wurde ebenfalls speziell optimiert. Systemaufrufe mit unvorhersehbarer Dauer wie Datei- oder Netzwerkoperationen führen dazu, dass der ausführende Thread den logischen Prozessor löst und in den Systemaufruf-Status übergeht, wodurch andere Threads diese Prozessoren übernehmen und Goroutinen ausführen können.
Dieses Entkoppeln von Blockaden sorgt dafür, dass I/O-gebundene Operationen nicht zu Performanceeinbrüchen führen und die parallele Ausführung anderer Goroutinen nicht eingeschränkt wird. Netzwerk- und Dateisystem-E/A arbeiten in Go mittels einer Kombination aus nicht-blockierendem I/O und effizienter Ereignisüberwachung-Technologien wie epoll (Linux), kqueue (macOS) oder IOCP (Windows). Die zentrale Komponente netpoll abstrahiert diese Schnittstellen, überwacht Datei-Deskriptoren asynchron und benachrichtigt beim Eintreffen von Daten oder Verfügbarkeit zur Schreiboperation. Dadurch lassen sich Zehntausende von Verbindungen mit vergleichsweise wenigen Threads skalieren und performant verarbeiten. Der Go-Scheduler ist auch eng mit dem Garbage Collector (GC) verflochten.
Garbage Collection wird simultan zur regulären Programmausführung durchgeführt, wobei spezielle GC-Goroutinen auf existierenden Prozessoren laufen, um Speicher freizugeben und Speicherlecks zu vermeiden. Diese Synchronisation zwischen Scheduler und GC trägt maßgeblich zu geringen Stop-the-World-Pausen bei und sorgt für eine hohe Anwendungs-Performance. Die Initialisierung und das Hochfahren des Schedulers erfolgt sehr früh im Startprozess eines Go-Programms. Dabei werden logische Prozessoren gemäß GOMAXPROCS initialisiert, die ersten Threads und systemeigenen Goroutinen wie sysmon gestartet und erste Werkzeuge für Speicherverwaltung eingerichtet. Der Scheduler übernimmt danach nahtlos die Steuerung der Parallelität und sorgt für eine dynamische und effiziente Verteilung der Last.
Für Entwickler ist es hilfreich, diese Architekturkonzepte zu verstehen, um Laufzeitverhalten und Performance ihrer Anwendungen besser einschätzen und optimieren zu können. Die Art, wie neue Goroutinen erstellt, aus Warteschlangen geholt und auf Threads ausgeführt werden, erklärt, wie Go sich von traditionellen Thread-Implementierungen unterscheidet. Zudem bietet die Möglichkeit, das Scheduling durch GOMAXPROCS einzustellen und das Verständnis von Preemption-Prozessen wichtige Werkzeuge für die Feinabstimmung von Go-Programmen. Zusammenfassend ist der Go Scheduler ein komplexes und hochentwickeltes System, das viele Herausforderungen der gleichzeitigen Ausführung adressiert. Es ermöglicht eine einfache API für Entwickler und gewährleistet dennoch geringe Latenzen, hohe Parallelität und ausgewogene Ressourcennutzung.
Die Entwicklung des GMP-Modells, die Integration von nicht-kooperativer Präemption, das effiziente Management von Systemaufrufen und das Event-basierte I/O machen Go zu einer der idealen Sprachen für moderne, skalierbare Anwendungen. Wer anfängt, Go zu programmieren und sich intensiv mit Nebenläufigkeit und paralleler Ausführung beschäftigt, kommt am Scheduler-Konzept nicht vorbei. Ein tieferes Verständnis davon öffnet das Tor zu hochperformanten Anwendungen und ermöglicht eine zielgerichtete Fehleranalyse im Produktivbetrieb. Das Go Scheduler-Modell hat sich über die Jahre bewährt und liefert eine faszinierende Kombination aus theoretischer Eleganz und praktischer Anwendbarkeit in der Softwareentwicklung.
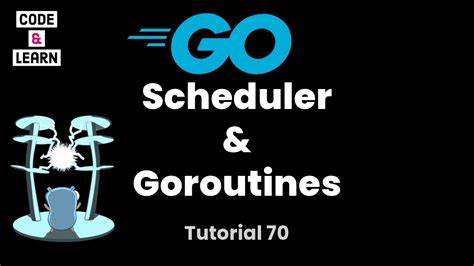





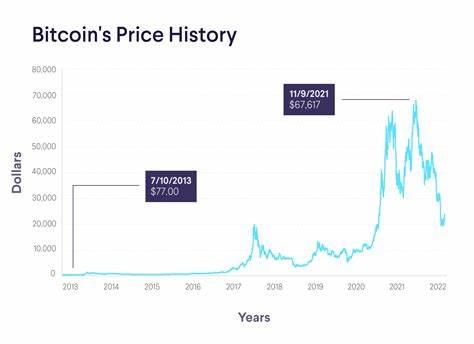


![Let's learn C: lesson 1 – by Salvatore Sanfilippo [video]](/images/A772CAF8-3737-42E5-8A6B-ABC150A9B692)