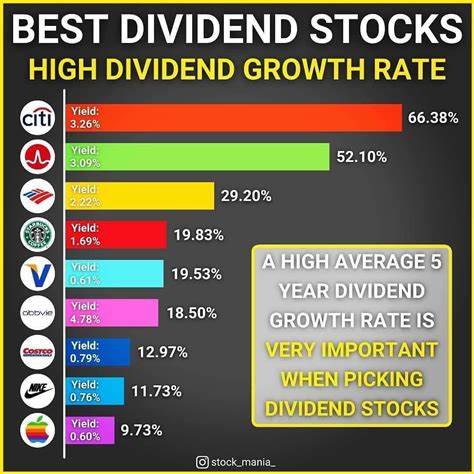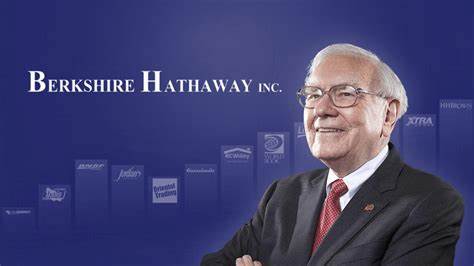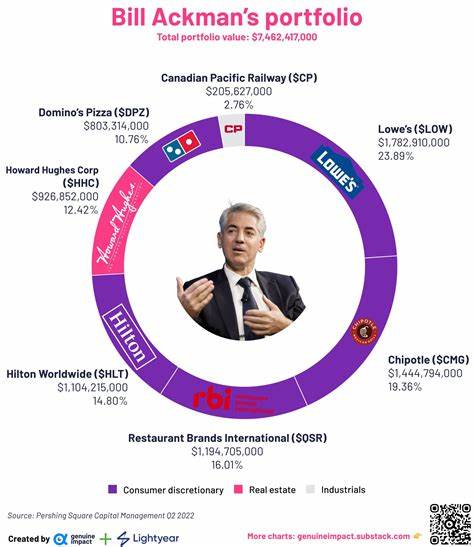Das Straßennetz in den Vereinigten Staaten bildet das Rückgrat der alltäglichen Mobilität und wirtschaftlichen Aktivität. Millionen von Fahrten finden täglich auf einem komplexen Geflecht aus Bundes-, Staats- und lokal verwalteten Straßen statt. Trotz der offensichtlichen Bedeutung aller Straßentypen zeigt eine eingehende Betrachtung der Finanzierungsströme eine signifikante Ungleichheit in Bezug auf die Mittelverwendung. Insbesondere tragen Nutzer lokal verwalteter Straßen – seien es städtische Nebenstraßen, Landstraßen oder kommunale Hauptverkehrsstraßen – erheblich zum Steueraufkommen bei. Dennoch erhalten die lokalen Verkehrssysteme anteilig deutlich weniger Investitionen zurück als die staatlichen Autobahnen und Hauptstraßen.
Dieses Ungleichgewicht führt nicht nur zu einem brüchigen Zustand vieler lokaler Straßen, sondern wirft auch grundsätzliche Fragen nach Gerechtigkeit und Effizienz im Verkehrshaushalt auf. Die Grundlage der öffentlichen Straßenfinanzierung in den USA ist das sogenannte Nutzerprinzip: Wer eine Straße benutzt, soll durch Steuern etwa auf Benzin diese Nutzung mitfinanzieren. Seit den 1930er Jahren werden vor allem die bundesstaatlichen und staatlichen Gassteuern verwendet, um Einnahmen zu generieren, die anschließend – zumindest im Idealfall – in den Erhalt und Ausbau des Straßennetzes zurückfließen. Zentral ist dabei der Highway Trust Fund, ein Treuhandfonds, der diese Steuereinnahmen verwaltet und an Bund, Länder und Kommunen verteilt. Trotz der theoretisch klaren Struktur zeigt die Praxis, dass die Verteilung der Mittel nicht den tatsächlichen Straßenbenutzern entsprechend erfolgt.
Im Jahr 2022 entfielen fast 34 Prozent aller in den USA gefahrenen Fahrzeugmeilen (Vehicle Miles Traveled, VMT) auf Straßen, die sich im Eigentum von lokalen Behörden befinden. Diese lokal verwalteten Straßen umfassen dabei rund 76 Prozent des gesamten Straßennetzes mit etwa 3,2 Millionen Meilen. Sie sind ein unverzichtbarer Teil jeder Fahrt, vom morgendlichen Schulweg über den Weg zur Arbeit bis hin zu langen Pendelstrecken, die immer auch einen Teil auf kommunalen Straßen beinhalten. Dennoch fließen von allen staatlichen Geldern, die für Straßeninstandhaltung und Ausbau ausgegeben werden, nur etwa 16 Prozent in lokale Straßenprojekte, ob direkt oder in Form von Zuschüssen an lokale Behörden. Diese Diskrepanz zwischen Nutzung und Investitionen hat deutliche Auswirkungen auf den Straßenzustand.
Während nur rund 11 Prozent der staatlichen Straßen als in schlechtem Zustand gelten, zeigt sich bei lokal verwalteten Straßen ein bedeutend schlechteres Bild. Dort sind über 36 Prozent der Straßen in einem schlechten Zustand, vor allem in urbanen Gebieten, wo bis zu 43 Prozent der Straßen der lokalen Verwaltung als mangelhaft eingestuft werden. Besonders gravierend ist die Situation auch bei den „anderen Hauptarterien“ – das sind bedeutende lokale Hauptverkehrsstraßen – die vergleichbar häufig bzw. noch häufiger Schäden aufweisen als ähnlich klassifizierte staatliche Straßen. Die Gründe für diese ungleiche Verteilung der Mittel sind eng mit den Mechanismen der Finanzierung verknüpft.
Bundesmittel aus dem Highway Trust Fund werden fast ausschließlich an die einzelnen Bundesstaaten verteilt. Diese wiederum haben weitgehende Rechte, darüber zu entscheiden, welcher Anteil ihrer Fördermittel in staatliche oder lokale Straßen investiert wird. Es gibt keine verbindlichen bundesstaatlichen Vorgaben, die sicherstellen, dass lokale Straßen einen Anteil erhalten, der ihrer Nutzung und den von ihnen generierten Steuereinnahmen entspricht. Die Folge ist ein System, in dem staatliche Prioritäten und politische Entscheidungen darüber entscheiden, wie an lokale Straßenmittel gelangt werden – wodurch de facto viele lokale Straßenbenutzer indirekt staatliche Autobahnprojekte subventionieren. Die politische Dimension spielt hier eine große Rolle.
Während es für viele Staaten durchaus verbreitet ist, einen angemessenen Teil der Mittel als Zuschüsse an lokale Verwaltungen weiterzuleiten, lassen sich gleichzeitig zahlreiche Fälle beobachten, wo lokale Interessen unterrepräsentiert sind. Bundesstaaten wie Maine, South Carolina und Virginia zeigen, dass eine größere Mittelweiterleitung an lokale Behörden möglich ist und die infrastrukturelle Situation vor Ort verbessert. Andere Staaten haben Nachholbedarf und könnten von bewährten Praktiken profitieren. Neben der Frage der Finanzierungsverteilung fehlt es auch an ausreichenden Daten zur genauen Verteilung der Gassteuererlöse nach Nutzungstyp und Straßeneigentümer. Die Bundessteuererhebung kann nicht differenzieren, wo genau Kraftstoffe konsumiert werden – ob auf Bundesautobahnen, Staatsstraßen oder lokalen Straßenabschnitten.
Das erschwert eine exakt bedarfsgerechte Mittelzuteilung. Die Folge ist eine politische Abhängigkeit von ungenauen Schätzungen, die tendenziell die dominant priorisierten staatlichen Straßen begünstigen. Auf der Ebene der Infrastrukturpolitik deutet dieser Zustand auf einen dringenden Reformbedarf hin. Zum einen könnten bundesweite Formelprogramme angepasst werden, um weniger ausschließlich die Bundesstaaten, sondern direkt auch Kommunen und regionale Partnerschaften als Empfänger aufzunehmen. Derzeit haben lokale Verwaltungen nur selten garantierten Zugriff auf Bundesmittel, oft sind sie auf wettbewerbsbasierte Zuschüsse angewiesen, die keine verlässliche Finanzierungsquelle darstellen.
Ein direktes Zuweisungssystem könnte für mehr Transparenz und ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Nutzung und Investition sorgen, was langfristig die Qualität des gesamten Straßennetzes verbessern würde. Darüber hinaus wäre eine Erweiterung der Erfassung und Überwachung des Zustands der Straßeninfrastruktur sinnvoll. Momentan konzentriert sich das Monitoring hauptsächlich auf die National Highway System (NHS)-Strecken, die mehrheitlich staatlich sind. Die Vernachlässigung von lokaler Infrastruktur im Datenmonitoring führt dazu, dass die erheblichen Investitionsbedarfe oft erst dann erkannt werden, wenn bereits erhebliche Schäden entstanden sind. Auf Landesebene können Regierungen ebenfalls proaktiv Maßnahmen ergreifen.
Einige Bundesstaaten haben begonnen, ihre Förderprogramme stärker an den Bedürfnissen der lokalen Infrastruktur auszurichten oder innovative Finanzierungsmodelle wie sog. „Fund Swapping“ zu praktizieren, bei dem Bundes- und Landesgelder in Regionen und Kommunen besser gebündelt und zielgerichtet eingesetzt werden. Andere Bundesstaaten können davon lernen und eine stärkere Kooperation mit ihren lokalen Partnern entwickeln. Die Finanzierung von Straßeninfrastruktur ist nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale und wirtschaftliche Frage. Lokale Straßen sind häufig der erste Kontaktpunkt für Bürger mit der öffentlichen Infrastruktur und haben erheblichen Einfluss auf Lebensqualität, wirtschaftliche Aktivitäten und Sicherheit.
Schlechte Straßen können nicht nur den Fahrzeugverschleiß erhöhen, sondern auch zu Verzögerungen, Verkehrsstaus und vermehrten Unfallrisiken führen. Indirekt beeinflussen sie zudem die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ganzer Regionen. Die Diskussion um die gerechte Aufteilung der Straßenfinanzierung ist somit untrennbar mit der Forderung nach einer nachhaltigen Verkehrs- und Wirtschaftsplanung verbunden. Der wachsende Druck auf öffentliche Kassen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur verlangt neue, transparente und faire Finanzierungsmechanismen. Die derzeitige Praxis, wonach lokale Straßenbenutzer im Grunde genommen mitfinanzieren, aber unterfinanziert bleiben, ist weder wirtschaftlich verantwortbar noch akzeptabel im Sinne eines ausgewogenen Gemeinwesens.
Mit Blick auf die Zukunft stehen Bundesgesetzgeber, Landesregierungen und Kommunen gemeinsam in der Verantwortung, die Finanzierung der Straßeninfrastruktur zu reformieren. Es gilt, Wege zu finden, um den „user pays“-Grundsatz wirklich verlässlich umzusetzen – und zwar über alle Ebenen hinweg. Neue Modelle könnten regionalen und lokalen Partnern einen garantierten Zugang zu Bundesmitteln sicherstellen, basierend auf objektiven Kriterien wie VMT-Zahlen und tatsächlichen Investitionsbedarfen. Das würde die Straßennutzer angemessen entschädigen und zugleich die Infrastrukturqualität nachhaltig verbessern. Die bevorstehende Auslaufphase wichtiger bundesgesetzlicher Programme wie des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) bietet eine Gelegenheit, diese Thematik auf die Agenda zu setzen und Fortschritte anzustoßen.