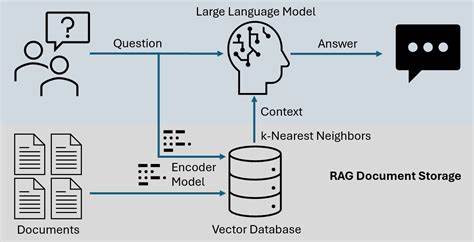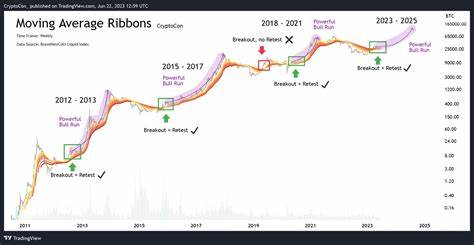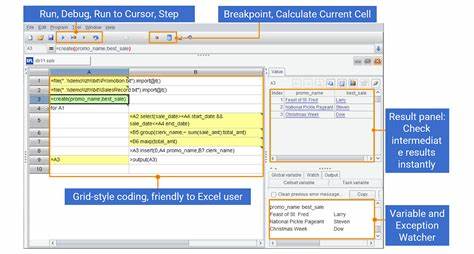Die digitale Werbelandschaft in Europa steht vor einer fundamentalen Zäsur. Am 14. Mai 2025 hat das belgische Berufungsgericht in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass das sogenannte Transparency & Consent Framework (TCF) keine rechtliche Grundlage hat. Das betrifft die Praxis des Tracking-basierten Werbens, die derzeit auf etwa 80 Prozent der Internetseiten weltweit implementiert ist. Die Konsequenzen dieses Urteils sind immens, da es die etablierte Art und Weise des Online-Datenschutzes und der Werbekonsentierung in Europa grundlegend infrage stellt.
Das Transparency & Consent Framework wurde von der Werbebranche, insbesondere durch den Verband IAB Europe, entwickelt, um auf Basis der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Einwilligung von Internetnutzern zur Verarbeitung persönlicher Daten für Werbezwecke einzuholen. Unternehmen wie Google, Microsoft, Amazon und X (ehemals Twitter) nutzen dieses System, um das Tracking von Nutzern zu legitimieren. Dabei werden über sogenannte Consent-Pop-ups auf Webseiten Nutzerdaten für profilbasierte Werbung gesammelt. Doch genau dieses System steht nun auf dem Prüfstand. Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Beschwerde des irischen Council for Civil Liberties (ICCL) und weiteren Datenschutzaktivistinnen und -aktivisten, die im Jahr 2018 erste Klagen gegen das Real-Time Bidding (RTB) Verfahren eingebracht hatten.
RTB ist ein Verfahren, bei dem Werbeplätze in Echtzeit an den Meistbietenden verkauft werden. Dies geschieht basierend auf umfangreichen Nutzerdaten, die von Webseiten und Apps gesammelt werden. Das Problem: Die Datenübermittlung in diesem Prozess erfolgt auf eine intransparente und oft unsichere Weise, wodurch Nutzerrechte massiv verletzt werden. Das belgische Gericht bestätigte die jahrelangen Bedenken der Klageführenden und der belgischen Datenschutzbehörde. Es stellte fest, dass das TCF nicht den Anforderungen der DSGVO entspricht und wesentliche Bestimmungen verletzt.
Besonders problematisch sind die Artikel zum Schutz personenbezogener Daten, die Anforderungen an Transparenz und Einwilligung sowie die Sicherstellung der Datensicherheit. Einer der zentralen Punkte ist, dass das TCF weder eine sichere Datenverarbeitung garantieren kann, noch die erforderliche rechtsgültige Einwilligung der Nutzer bestätigt. Dies liegt unter anderem daran, dass das Tracking in der RTB-Werbung permanent und umfassend erfolgt, was es technisch unmöglich macht, eine informierte Einwilligung einzuholen oder die Nutzer ausreichend über die Datenverarbeitung aufzuklären. Zusätzlich wird die Weitergabe von Daten an eine unüberschaubare Anzahl von Datenverarbeitern kaum kontrolliert oder dokumentiert. Darüber hinaus hat das Gericht festgestellt, dass das TCF teilweise auf die sogenannte „berechtigte Interessensverarbeitung“ setzt, eine datenschutzrechtliche Grundlage, die hier nicht zulässig ist.
Die Risiken des Trackings sind so hoch, dass diese Verarbeitung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung erfolgen darf. Dies widerspricht dem Versuch der Werbeindustrie, mithilfe des TCF die notwendige Nutzerzustimmung zu umgehen. Das Urteil stärkt somit die Rechte von Internetnutzern gegenüber der Werbeindustrie und fordert eine grundlegende Reform der aktuellen Praktiken im Online-Marketing. Es wird deutlich, dass die bisherigen Einwilligungserklärungen über Cookie-Banner und ähnliche Mechanismen oft nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und in ihrer jetzigen Form rechtswidrig sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wirkung dieses Urteils auf die gesamte EU.
Obwohl es ein belgisches Gerichtsurteil ist, entfaltet es faktisch unmittelbare Gültigkeit für alle Mitgliedstaaten aufgrund der europäischen Datenschutzgesetzgebung. Unternehmen, die in Europa Daten verarbeiten oder Werbung schalten, müssen sich an diese Entscheidung halten und ihre Systeme entsprechend anpassen. Für die Werbebranche bedeutet dies, dass das gewohnte Modell der personalisierten, datengetriebenen Werbung auf der Grundlage eingefangener Nutzerprofile neu gedacht werden muss. Alternative Methoden, die weniger auf umfassender Datensammlung basieren oder sogar ganz ohne personenbezogene Daten auskommen, rücken nun in den Fokus. Diese Innovationen könnten nicht nur datenschutzkonform sein, sondern auch das Vertrauen der Nutzer langfristig zurückgewinnen.
Aus Sicht der Verbraucherschützer und Datenschützer ist das Urteil ein bedeutender Schritt hin zu mehr Kontrolle über die eigenen Daten und macht deutlich, dass Datenschutzrechte nicht nur formale Hürden, sondern echte Schutzmechanismen sein müssen. Die Praxis, Nutzer mit dauernden Cookie-Einwilligungen zu bombardieren, die eher zur Ablenkung als zur Aufklärung dienen, wird damit endgültig infrage gestellt. Die Reaktion der großen Tech-Konzerne und der Werbeverbände folgte prompt. Viele erklärten, man werde die Entscheidung prüfen und gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen, um die Rechtmäßigkeit des TCF zu sichern. Andere versprechen aber bereits, ihre Werbesysteme zu überarbeiten und stärker auf Datenschutz zu achten.
Trotz des Widerstands ist klar, dass der Datenschutz in Europa an Bedeutung gewinnt und Unternehmen sich zunehmend an strenge Vorgaben anpassen müssen. Für Nutzer signalisiert das Urteil einen stärkeren Schutz der eigenen Privatsphäre im Online-Bereich und eine bessere Kontrolle darüber, wie ihre Daten genutzt werden. Zukünftige Entwicklungen werden zeigen, wie schnell die Branche innovative und datenschutzfreundliche Lösungen findet, um personalisierte Werbung weiterhin möglich zu machen. Es besteht die Chance, dass neuartige Ansätze, etwa durch kontextbasierte Werbung oder dezentralisierte Datenverarbeitung, die bisherigen problematischen Formen des Trackings ersetzen können. Zusammenfassend markiert das Urteil des belgischen Berufungsgerichts vom Mai 2025 einen Wendepunkt in der europäischen Datenschutzlandschaft und der digitalen Werbewirtschaft.
Das Ende des Transparency & Consent Frameworks als rechtliche Grundlage für Tracking-basierte Werbung unterstreicht die Wichtigkeit effektiven Datenschutzes und unabhängiger Kontrolle. Für Verbraucher eröffnen sich bessere Möglichkeiten, ihre Privatsphäre im Netz zu schützen, während Unternehmen vor der Herausforderung stehen, funktionierende Alternativen zu etablieren. Es bleibt spannend, wie sich die juristische und mediale Diskussion um Datenschutz und Online-Werbung in den kommenden Monaten und Jahren weiterentwickelt. Klar ist jedoch, dass die Ära der unkontrollierten Datenverarbeitung und „Sham“-Consent-Popups auf Europas Webseiten vorerst ein Ende gefunden hat.
![EU ruling: tracking-based advertising [...] across Europe has no legal basis](/images/1C8C02AF-85A6-4F5B-A7A2-B905DBDF8966)