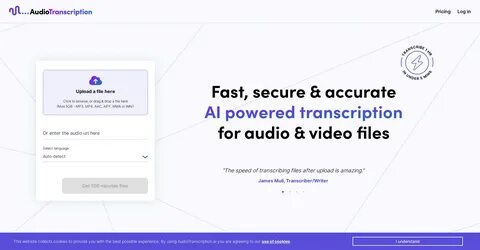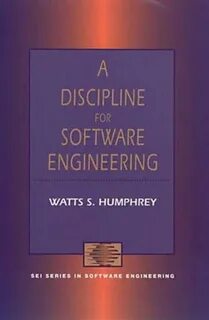Inmitten der rasant fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat Senator Ted Cruz (R-Texas) einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der für erheblichen Wirbel sorgt. Er fordert, dass Bundesstaaten, die eigene Regelungen zur KI einführen, von der Verteilung der umfangreichen Fördermittel für den Breitbandausbau im Wert von 42 Milliarden US-Dollar ausgeschlossen werden. Dieses Vorhaben weckt nicht nur heftige Debatten über technologische Innovation und Regulierung, sondern auch darüber, wie weit die Bundesregierung und einzelne Politiker bei der Einflussnahme auf staatliche Politik gehen dürfen. Dabei stehen Fragen der demokratischen Selbstbestimmung, der technologischen Zukunftsfähigkeit und der sozialen Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Das Gesetzespaket rund um das sogenannte BEAD-Programm (Broadband Equity, Access, and Deployment) sieht vor, Fördermittel vor allem dafür einzusetzen, die Internetinfrastruktur in unterversorgten Regionen der USA auszubauen.
Ursprünglich zielte das Programm darauf ab, die Versorgung mit schnellem und zuverlässigem Internet zu verbessern, um digitale Teilhabe zu stärken und wirtschaftliche Chancen zu erweitern. Nun soll mit dem Einfluss von Cruz ein zusätzlicher Aspekt hinzukommen: Digitale Infrastruktur und der Ausbau von KI-Systemen sollen zwar gefördert werden, allerdings unter der Bedingung, dass Staaten innerhalb der nächsten zehn Jahre keine eigenen Gesetze beschließen, die die Entwicklung oder den Einsatz von KI regulieren. Diese Verknüpfung von Fördergeldern und einer Art Interessenbindung an die kapitalfreundliche, wenig regulierte Entwicklung von KI ruft zahlreiche Kritiker auf den Plan. Verbraucherschutzorganisationen, Datenschützer und etliche Experten warnen davor, dass hier demokratisch legitimierte Schutzmaßnahmen zugunsten von Freiheiten für Unternehmen ausgehebelt werden. Die Organisation Public Citizen bezeichnet den Vorschlag als „undemokratisch und grausam“.
Der Vorwurf lautet, dass den Bürgerinnen und Bürgern eine echte Wahl verweigert wird: Sie können zwar vom Ausbau des Breitbandinternets profitieren, müssen dafür aber den Verzicht auf potenziell notwendige Schutzmechanismen im Umgang mit einer der mächtigsten Technologien der Gegenwart hinnehmen. Das Vorhaben konnte auch parteiübergreifend deutliches Echo erzeugen. Befürworter argumentieren, dass eine strikte Regulierung von KI Innovationen behindern und die USA im globalen Wettbewerb, insbesondere mit China und der Europäischen Union, zurückwerfen könnte. Die Moratoriumsfrist von zehn Jahren soll der Branche Planungssicherheit geben und das Wachstum ermutigen. Außerdem soll durch die Förderungen die technologische Infrastruktur nicht nur ausgebaut, sondern auch intelligent für innovative Systeme nutzbar gemacht werden, unter anderem durch den Einsatz automatisierter Entscheidungen.
Gleichzeitig gibt es massive Zweifel, ob ein solches einseitiges Vorgehen die gesellschaftlichen Bedürfnisse widerspiegelt. KI wird als Technologie verstanden, die nicht nur Chancen birgt, sondern auch Risiken für Privatsphäre, Sicherheit, Diskriminierung und Arbeitsplätze. Besonders wenn Staaten eigene Gesetze verabschieden, geht es meist darum, Bürgerinnen und Bürger vor möglichen Missbräuchen zu schützen oder ethische Leitplanken zu etablieren. Die Verknüpfung mit Fördermitteln wird daher als Druckmittel wahrgenommen, das die demokratische Selbstbestimmung der Bundesstaaten einschränkt. Zudem zeigt sich einer der zentralen Konflikte an einem anderen Aspekt des BEAD-Programms: Die Trump-geführte Regierung hat begonnen, die ursprünglichen Förderrichtlinien zu überarbeiten und setzt dabei auf eine marktliberale Ausrichtung.
So wurde beispielsweise die bisherige Bevorzugung von Glasfasertechnologien aufgehoben, die als nachhaltiger und leistungsfähiger gelten. Stattdessen sollen nun auch Kabelnetze, fest installierte drahtlose Anbieter sowie Satellitensysteme wie Starlink stärker berücksichtigt werden. Kritiker vermuten, diese Änderungen seien vor allem darauf ausgerichtet, Investitionen und Marktmacht großer Unternehmen wie Kabelkonzerne zu stärken und staatliche Vorgaben zu minimieren. Diese Entwicklung steht im Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und dem Ziel, qualitativ hochwertige Infrastruktur möglichst flächendeckend aufzubauen. Glasfasernetze sind zwar teurer und aufwendiger, bieten jedoch langfristig mehr Stabilität und Bandbreite, was gerade für KI-Anwendungen von großer Bedeutung sein kann.
Die Abkehr von einer Technologiepause zugunsten kostengünstigerer, aber weniger zukunftssicherer Lösungen birgt das Risiko, dass Investitionen in den Breitbandausbau zwar kurzfristig steigen, langfristig aber Infrastrukturprobleme und mangelnde Leistungsfähigkeit zunehmen. Ein weiterer Streitpunkt ist die Abschaffung der Vorgabe, dass Fördermittelempfänger günstige Internettarife für einkommensschwache Haushalte anbieten müssen. Diese steuerlich und sozialpolitisch relevante Maßnahme wird vom neuen Ansatz zurückgenommen, was das Risiko der digitalen Spaltung verschärft. Der Zugang zum Internet wird so stärker von Marktkriterien abhängig gemacht, was gerade in ländlichen und benachteiligten Regionen problematisch sein kann. Damit könnte ein Ziel des BEAD-Programms – nämlich digitale Teilhabe für alle – deutlich verwässert werden.
Insgesamt wird das Cruz-Gesetzesvorhaben zu kontroversen Auseinandersetzungen über die Zukunft von Technologiepolitik, Föderalismus und Sozialpolitik führen. Das Thema KI-Regulierung ist international von großer Brisanz: Während die EU bereits mit umfassenden Vorschriften versucht, ethische und sicherheitstechnische Standards zu setzen, schlagen Teile der US-Politik einen weit weniger regulierten Kurs ein, der Innovation über Schutz stellt. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung von KI-Technologien und deren gesellschaftliche Wirkung haben. Die Frage nach der richtigen Balance zwischen Förderung und Regulierung, Freiheit und Sicherheit, Innovation und Gefahrenabwehr steht im Mittelpunkt der politischen Debatte. Senator Cruz nutzt das schwere Förderinstrument des BEAD-Programms als Druckmittel, um eine landesweit einheitliche, minimale Regulierungspolitik zu erzwingen.