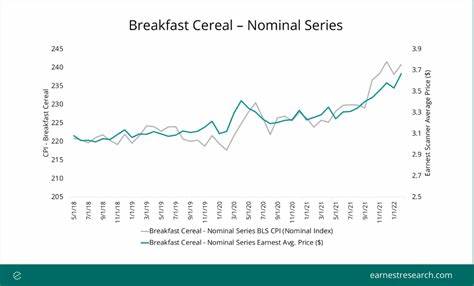Die Wahl eines neuen Papstes ist eines der geheimnisvollsten und traditionsreichsten Ereignisse in der globalen Religionslandschaft. Seit Jahrhunderten findet die Konklave in den Vatikanischen Mauern statt – ein abgeschotteter, mehrstufiger Wahlprozess, bei dem 133 Kardinäle in geheimer Abstimmung den Oberhaupt der katholischen Kirche bestimmen. In den letzten Jahren rückte die künstliche Intelligenz (KI) vermehrt auch in Bereiche vor, die früher als unzugänglich für datengetriebene Analysen galten, darunter eben auch die Vorhersage von Wahlergebnissen verschiedenster Art. Die Frage, ob KI den nächsten Papst schon im Voraus präzise vorhersagen kann, ist dabei besonders spannend und wirft ein Licht auf die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen moderner Technologien in einem derart komplexen politischen und ideologischen Kontext. Im Mai 2025 begannen die Kardinalwähler ihr neues Konklave, um den 267.
Papst zu bestimmen. In den Tagen zuvor hatten Forscher aus mehreren Ländern versucht, mit modernen maschinellen Lernverfahren und algorithmischen Modellen den Ausgang dieser Wahl vorherzusagen. Dabei lag der Fokus darauf, die ideologischen und politischen Strömungen innerhalb des Kardinalskollegiums zu analysieren und durch ein datenbasiertes Modell eine Reihenfolge der potentiellen Favoriten zu erstellen. Überraschend war jedoch, dass die tatsächliche Wahl von Kardinal Robert Prevost aus den USA einerseits unerwartet kam und andererseits von der KI nicht als führender Kandidat betrachtet wurde. Der verwendete Algorithmus basierte hauptsächlich auf historischen Daten, und zwar auf detaillierten Analysen der letzten fünfhundert Jahre genealogischer Verbindungen zwischen Bischöfen und Kardinälen sowie deren ideologischer Ausrichtung.
Dabei werden Nachfolgeentscheidungen und Ernennungen in der Kirche als Indikatoren für gemeinsame politische und theologische Einstellungen gewertet. Die Forscher identifizierten vier zentrale Themen, die im Wahlprozess eine Rolle spielen könnten: Einstellungen gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren, internationale Migration und Armut, interreligiöser Dialog sowie das Konzept der Synodalität – also die Autonomie der lokalen Kirchen im Verhältnis zum Vatikan. Die Bewertungen der einzelnen Kardinäle wurden aufgrund ihrer öffentlichen Stellungnahmen durchforstet, um ihre wahrscheinliche Haltung zu diesen Themen zu ermitteln. Im Modell belegte der italienische Kardinal Pietro Parolin, der derzeitige Staatssekretär des Vatikans, die Spitzenposition. Parolin gilt als erfahrener Diplomat und eine Persönlichkeit, die sowohl progressive als auch konservative Fraktionen innerhalb der Kirche ausbalancieren kann.
Zudem war Parolin auch einer der Top-Favoriten in diversen Wetten rund um den Papstwahlprozess. Überraschend waren weitere Kandidaten, die im Modell gut abschnitten, etwa der südafrikanische Erzbischof Stephen Brislin und der philippinische Kardinal Luis Antonio Tagle, die beide als moderat-progressiv gelten und jeweils ihre regionalen Gemeinden repräsentieren. Die KI-Analyse zeigte außerdem, dass je nach Schwerpunktsetzung des Wahlinstruments – ob Migration, Armut oder Synodalität – sich unterschiedliche Kandidaten als Favoriten herauskristallisierten, so zum Beispiel der italienische Erzbischof Matteo Zuppi, der sich offen gegen migrationsfeindliche Politiken positioniert. Der tatsächliche Ausgang der Konklave jedoch wich von diesen Prognosen deutlich ab. Robert Prevost, dessen ideologische Positionen im Modell als mittelmäßig zentriert bewertet wurden, wurde zum neuen Papst gewählt, was von vielen als ein Kompromiss- oder Ausgleichskandidat verstanden wird.
Die Wahl eines US-amerikanischen Papstes könnte zudem als strategisch bedeutsam gedeutet werden, um insbesondere die große katholische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten stärker einzubinden und zu repräsentieren. Die Diskrepanz zwischen KI-Vorhersage und realem Ergebnis lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Zum einen fehlten im Modell elementare politische und geografische Einflüsse, die bei einer solchen Wahl eine maßgebliche Rolle spielen. Die komplexen Verhandlungs- und Lobbyingprozesse, die im Schutz des Konklaves stattfinden, sind schwer zu quantifizieren und bleiben für Forscher oft unzugänglich. Zudem sind öffentliche Äußerungen der Kardinäle nicht zwangsläufig deckungsgleich mit ihren tatsächlichen Überzeugungen oder taktischen Überlegungen, was die Datenlage weiter erschwert.
Letztlich spielen auch informelle soziale Dynamiken eine Rolle: Während der Wahl sind die Kardinäle in gemeinsamen Quartieren isoliert, verbringen viel Zeit miteinander und führen intensive Gespräche, die eine Anpassung der Wahlpräferenzen im Verlauf des Konklaves ermöglichen. Viele Experten sind dennoch davon überzeugt, dass die Methodik, die ideologischen Profile der Wahlmänner maschinell zu erfassen und Wahlprozesse zu simulieren, ein vielversprechendes Forschungsfeld darstellt. Insbesondere bei allgemeineren politischen Wahlen mit größerer Teilnehmerschaft könnten solche Modelle durch Einbezug von Social-Media-Analysen, Reden und weiteren kommunikativen Daten bessere Prognosen liefern. Im Fall des Papstwahlprozesses wäre die Erweiterung der Modelle um geopolitische Aspekte, persönliche Netzwerke und saisonale Trends wünschenswert, auch wenn die praktische Umsetzung herausfordernd bleibt. Die Wahl eines neuen Papstes ist also trotz technologischer Fortschritte nach wie vor ein zutiefst menschliches, komplexes und überraschendes Ereignis.