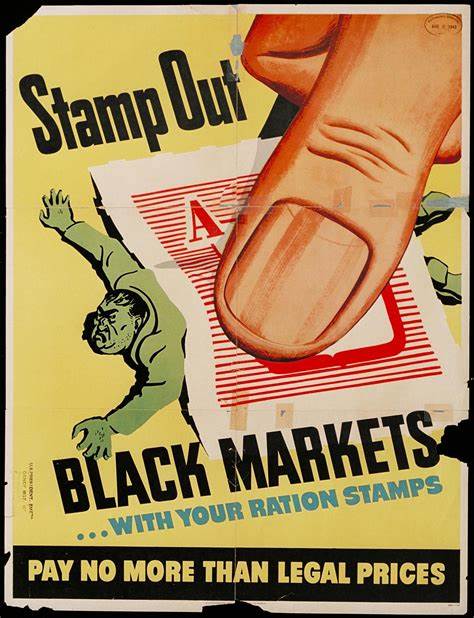In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz immer mehr Bereiche unseres Lebens durchdringt, wird auch das Thema Schreiben und Textproduktion neu bewertet. Besonders ChatGPT und ähnliche generative KI-Modelle stehen im Mittelpunkt einer intensiven Diskussion. Manche Menschen verteufeln die Nutzung dieser Technologien, andere zeigen sich offen und experimentierfreudig. Doch am Ende der Debatte bleibt eine einfache Wahrheit: Es ist letztlich egal, ob ein Text von einem Menschen, einer künstlichen Intelligenz oder einer Kombination aus beiden erstellt wurde. Entscheidend ist die Qualität des Ergebnisses, das beim Leser ankommt.
Die traditionelle Wertschätzung für rein menschlich geschriebene Texte geht oft davon aus, dass nur solche Werke echte Kreativität, Tiefe und Authentizität transportieren können. Diese Haltung ist zwar verständlich, aber steht heutzutage auf dünnem Eis. Schon lange gibt es Texte, die auf den ersten Blick oder sogar nach intensiverer Betrachtung nur wenig von substanziellem Gehalt haben – sei es wegen schlechter Recherche, langweiliger Formulierungen oder einer stumpfen Wiederholung von Allgemeinplatzwissen. Man darf nicht vergessen, dass auch früher schon gerade minderwertige Inhalte veröffentlicht wurden, die kaum einen Mehrwert bieten und sich kaum von KI-generierten Texten unterscheiden. Interessanterweise erkennen viele Leser schnell, ob ein Text von einer Künstlichen Intelligenz stammt oder nicht – zumindest aktuell ist diese Fähigkeit noch vorhanden.
Doch die Unterscheidung ist oft irrelevant, da die meisten Menschen ohnehin eher getrieben sind von der Frage, ob sie in einem Text hilfreiche Informationen, interessante Perspektiven oder eine angenehme Lektüre finden. Im Journalismus beispielsweise zeigt sich ein ambivalentes Bild. Viele Medienhäuser fühlen sich betrogen, dass ihre redaktionellen Inhalte von KI-Systemen quasi aufgezehrt und neu ausgespuckt werden. Gleichzeitig ist kaum eine Redaktion, die nicht zumindest vorsichtig mit generativen KI-Werkzeugen experimentiert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass solche Werkzeuge Texte effizient zusammenfassen, Fakten überprüfen oder repetitive Aufgaben erleichtern können.
Hier wird klar: Worte sind letztlich Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein rein menschlich geschriebener Text per se besser ist. Genauso irrt man, wenn man annimmt, dass von einer KI generierte Texte zwangsläufig schlecht oder seelenlos sind. Qualität entsteht vielmehr durch Inhalt, Struktur, Klarheit und letztlich auch durch den Zweck, den der Text erfüllen soll. Ein schlecht geschriebenes Stück bleibt schlecht, unabhängig vom Autor oder von der Technologie, die genutzt wurde.
Die Angst vor einer Entwertung des Schreibens durch KI darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Menschen schon jetzt digitale Hilfsmittel im Alltag nutzen. Rechtschreibprüfung, Grammatikchecks oder automatische Übersetzungen sind längst banal und für den großen Teil der Nutzer unverzichtbar. Warum also sollte die Einbindung einer KI einen so großen Unterschied machen? Wenn ein Text durch eine KI unterstützt wird, der Leser aber keine Verschlechterung merkt, warum sollte das als negativ bewertet werden? Im Gegenteil: Es ist denkbar, dass KI in Zukunft die Qualität vieler Texte verbessern könnte, indem sie Routinearbeit übernimmt und Autoren so den Freiraum gibt, sich auf kreativere und tiefgründigere Aspekte zu konzentrieren. Gerade im Bereich Übersetzung sieht man heute schon beeindruckende Fortschritte, die zuvor undenkbar waren. KI macht komplexe Sprachaufgaben schneller und oft präziser als viele Menschen.
Daraus ergibt sich die Chance, einen globaleren Diskurs zu führen, der von sprachlichen Barrieren weniger eingeschränkt wird. Ein weiterer Punkt ist Transparenz und Offenheit im Umgang mit KI. Manche Unternehmen und Autorinnen und Autoren fühlen sich verpflichtet, jede Nutzung von KI offen zu legen. Das ist nachvollziehbar, führt aber manchmal auch zu einer Überbetonung eines Faktors, der für den Leser kaum relevant ist. Ein Text sollte vor allem danach bewertet werden, wie er wirkt und welchen Nutzen er stiftet – nicht danach, auf welchem Weg er entstanden ist.
Ein praktisches Beispiel aus der Praxis illustriert diesen Gedanken: Eine Nachrichtenseite veröffentlicht einen langen Artikel über ein neues Smartphone-Modell. Die wichtigsten Informationen zum Preis und der Verfügbarkeit werden erst nach mehr als der Hälfte des Textes genannt, weil der Artikel künstlich in die Länge gezogen wird, um Suchmaschinen-Rankings zu erhalten. Ein KI-System liefert hingegen eine kurze, prägnante Antwort mit den relevanten Details innerhalb von wenigen Sätzen. Aus Nutzersicht ist klar, welches Angebot hilfreicher ist, egal ob ein Mensch oder ein Algorithmus dahintersteckt. Im kreativen Bereich bleibt die Frage spannend, wie weit KI die Schaffung von Kunst und Literatur beeinflussen wird.
Dabei ist es wichtig, nicht in Meta-Diskussionen über Authentizität und Originalität zu verfallen, sondern den Blick auf das zu richten, was ein Text leistet. Viele kreative Tätigkeiten sind ein Zusammenspiel verschiedener Einflüsse, Inspirationen und Mittel. Hilfsmittel gibt es schon seit Jahrhunderten – von Schreibmaschinen über Textverarbeitungsprogramme bis hin zum Internet als Recherchequelle. KI kann als nächster Schritt in diesem Entwicklungspfad verstanden werden. Aus Sicht der Leserinnen und Leser stellt sich zudem die Frage, wie feinfühlig sie Unterschiede zwischen menschlicher und KI-generierter Sprache wahrnehmen.
Wer offen bleibt und sich auf den Inhalt konzentriert, wird feststellen, dass diese Unterscheidung zunehmend verschwimmt. Ebenso entwickeln sich KI-Systeme kontinuierlich weiter und lernen, emotionalere, kreativere und kontextbewusstere Texte zu erstellen. Letztlich zeigt sich, dass die Diskussion über KI im Schreibprozess vor allem eines ist: ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen und kulturellen Ängste bezüglich Veränderung. Wie bei jeder technologischen Innovation gilt es, Chancen und Risiken objektiv abzuwägen. Statt strikt eine Grenze zu ziehen, ob ein Text menschlich oder maschinell erzeugt ist, sollte man besser danach schauen, welchen Wert und welche Wirkung der Text wirklich hat.
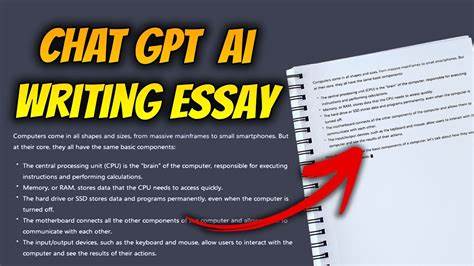



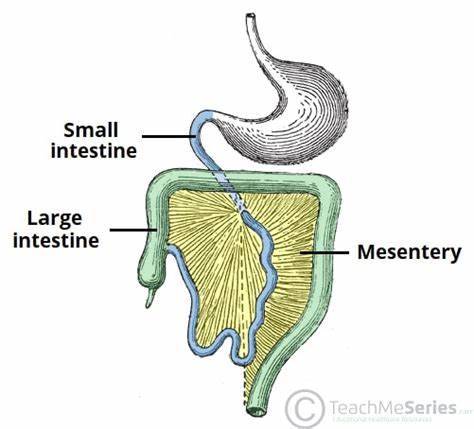
![Dijkstra on computer addiction (1991) [pdf]](/images/CDABF1FD-B9D5-4282-BD4C-E71C22A4E2D0)