In der Filmwelt gibt es zahlreiche Geschichten, die hinter den Kulissen ablaufen und dem Zuschauer oft verborgen bleiben. Eine dieser Geschichten ist die des Pseudonyms Alan Smithee – ein Name, der in der Filmbranche fast legendären Status erreicht hat. Dieser Name ist kein gewöhnlicher Künstlername, sondern steht für Regisseure, die sich von einem Werk distanzieren wollten, das nicht ihren kreativen Vorstellungen entsprach. Doch wie entstand dieses Pseudonym, warum wurde es genutzt und wie wurde es über die Jahre in verschiedenen Medien eingesetzt? Die Antwort auf diese Fragen präsentiert sich als faszinierender Einblick in einen oft konfliktbeladenen Bereich der Film- und Fernsehproduktion. Der Ursprung von Alan Smithee datiert zurück in die späten 1960er Jahre.
Bis 1968 konnten Regisseure nicht ohne Weiteres ihre Namen von einem Filmprojekt entfernen lassen. Die Richtlinien der Directors Guild of America (DGA) bestimmten, dass Regisseure für ihre Werke persönlich verantwortlich sind, was auch Teil der Unterstützung der „auteur theory“ war. Diese Theorie sieht den Regisseur als maßgebliche kreative Kraft hinter einem Film. Doch was passiert, wenn der Regisseur mit der finalen Fassung seines Films nicht einverstanden ist, etwa aufgrund von Einmischungen durch Produzenten oder Änderungen, die seiner kreativen Vision widersprechen? Hier setzt die Geschichte von Alan Smithee ein. Die erste dokumentierte Verwendung des Pseudonyms erfolgte bei dem Film „Death of a Gunfighter“ aus dem Jahr 1969.
Während der Produktion kam es zu einem Streit zwischen dem Hauptdarsteller Richard Widmark und dem Regisseur Robert Totten, woraufhin Don Siegel die Regie übernahm. Beide Regisseure waren unzufrieden mit dem Endprodukt und weigerten sich, ihren Namen zu übernehmen. Die DGA entschied daraufhin, einen fiktiven Namen als Regisseur anzugeben. Ursprünglich sollte „Al Smith“ verwendet werden, doch der Name war zu verbreitet und in der Branche bereits vergeben. Man änderte ihn zunächst zu „Smithe“ und später zu „Smithee“, wobei schließlich die heute bekannte Form „Alan Smithee“ entstand.
Der Name war bewusst so gewählt, dass er unauffällig genug war, um nicht sofort Fragen zu wecken, aber dennoch einzigartig genug, um nicht mit echten Namen verwechselt zu werden. Bereits bei diesem ersten Einsatz erregte der Pseudonym ein gewisses Aufsehen. Kritiker lobten den Regisseur „Alan Smithee“, ohne zu wissen, dass es sich lediglich um ein Platzhalter-Pseudonym handelte, das auf kreative Konflikte hinwies. Mit der Zeit nutzten immer mehr Regisseure in ähnlicher Situation den Namen Alan Smithee, um deutlich zu machen, dass das veröffentlichte Werk nicht ihrem ursprünglichen kreativen Anspruch entsprach. Die DGA legte dabei strenge Regeln fest: Der Regisseur durfte nicht öffentlich erklären, dass Alan Smithee verwendet wurde, um sich vor negativen Konsequenzen zu schützen bzw.
Verwirrung zu vermeiden. Alan Smithee wurde vorwiegend im Filmbereich eingesetzt, doch die Nutzung erweiterte sich schnell auf Fernsehen, Musikvideos und sogar Videospiele und Comics. Vor allem bei TV-Sendungen oder episodischen Formaten fand sich der Name häufig wieder, wenn Regisseure oder Kreative mit der finalen Schnittfassung oder der künstlerischen Kontrolle unzufrieden waren. Die Bezeichnung fungierte hier als stiller Protest oder als Hinweis darauf, dass eine Produktion Veränderungen unterliegen musste, die nicht vom ursprünglichen Macher stammten. Ein besonders bekanntes Beispiel, das den Mythos und die Problematik um Alan Smithee verdeutlichte, ist der Film „An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn“ aus dem Jahr 1997.
In dessen Handlung geht es genau um die Unmöglichkeit, sich von einem Film unter dem regulären eigenen Namen zu distanzieren und stattdessen den Namen Alan Smithee zu verwenden. Ironischerweise wurde der Regisseur Arthur Hiller selbst durch Produzenteninterventionen so unzufrieden, dass er tatsächlich seinen Namen vom Film entfernte und ihn stattdessen mit Alan Smithee kreditieren ließ. Der Film setzte dem Pseudonym somit ein Denkmal, das jedoch durch den kommerziellen Misserfolg und die ungewöhnliche öffentliche Aufmerksamkeit auch zum Niedergang dieser Praxis beitrug. Infolgedessen wurde das Pseudonym von der Directors Guild of America offiziell eingestellt. Für spätere Fälle wurden wie bei „Supernova“ und „Accidental Love“ alternative Pseudonyme wie Thomas Lee oder Stephen Greene verwendet.
Dennoch lebt das Konzept des Alan Smithee inoffiziell weiter und findet nach wie vor Anwendung außerhalb der DGA und in anderen Medienbereichen, beispielsweise bei Autoren, Musikvideoregisseuren oder in der Welt der Computerspiele. Die Nutzung von Alan Smithee war und ist eine Form des künstlerischen Selbstschutzes. Gerade in einem Umfeld, das durch viel Geld, Produktionsdruck und kreative Kompromisse geprägt ist, kann die Möglichkeit, ein Werk anonym oder unter einem fiktiven Namen zu veröffentlichen, für die Betroffenen eine willkommene Option sein. Dieses Pseudonym stellt damit eine Art stillen Protest gegen Eingriffe in die künstlerische Freiheit dar, ohne dabei direkt in der Öffentlichkeit anecken zu müssen. In der heutigen, digitalisierten Welt, in der Film- und Medieninhalte über viele Plattformen verteilt und weithin zugänglich sind, hat die Bedeutung von Alan Smithee zwar abgenommen, doch der Geist dahinter bleibt aktuell.
Probleme rund um kreative Kontrolle, Urheberschaft und künstlerische Integrität sind längst nicht gelöst. In den vergangenen Jahren wurde häufig über neue Formen der Anerkennung bzw. Ablehnung von Credits diskutiert, teilweise durch vertragliche Regelungen oder öffentlich gewordene Kontroversen. Die Geschichte von Alan Smithee bleibt daher eine wegweisende Episode, die illustriert, wie kreativ und pragmatisch die Branche auf Herausforderungen reagiert. Der Name Alan Smithee ist inzwischen auch ein Symbol – für den Schatten, den Regisseure manchmal hinterlassen.
Er mahnt, dass hinter jeder Produktion eine komplexe Geschichte steckt, nicht zuletzt auch von Konflikten und Kompromissen. Ebenso zeigt er auf humorvolle und zugleich ernste Weise, wie Künstler mit diesen Situationen umgehen. Darüber hinaus hat Alan Smithee Einzug in die Popkultur gehalten. Neben seiner Verwendung in Filmen und Serien wurde der Name in Comics, Videospielen und sogar Musikvideos als Symbol für kreative Unzufriedenheit verwendet. Diese weitreichende Rezeption verdeutlicht, wie tief verwurzelt das Thema des verlorenen oder aufgegebenen Urheberrechts beziehungsweise der Diskrepanz zwischen künstlerischem Anspruch und finalem Produkt in der Massenkultur ist.
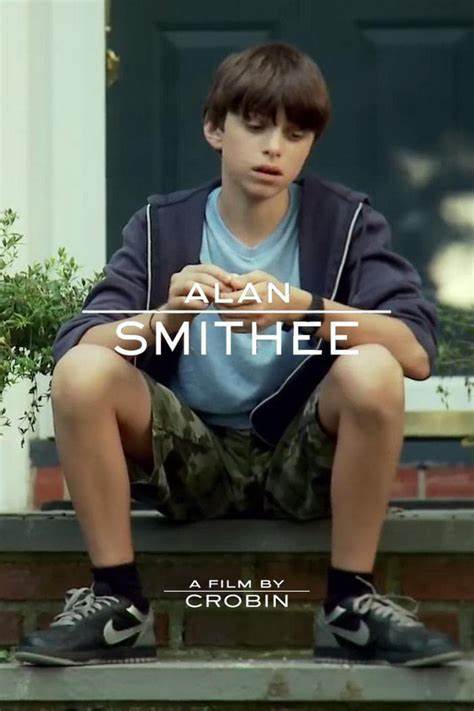


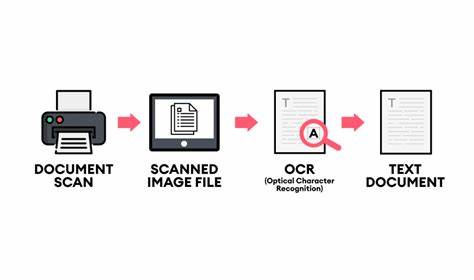



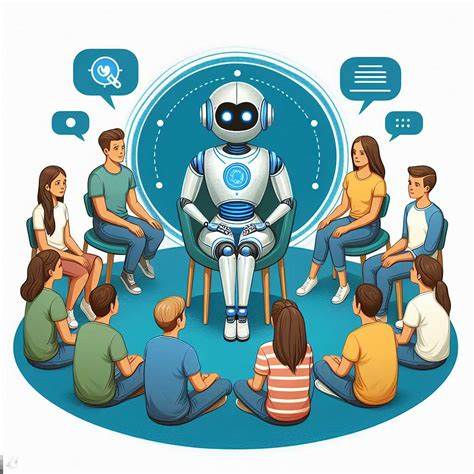
![The Slow Winter (2013) [pdf]](/images/F07D2D60-5699-47F7-867D-8071806FAB37)
