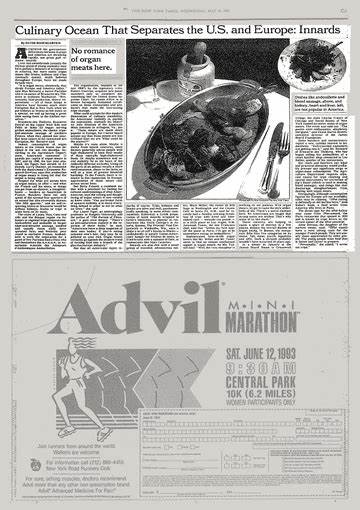Die tiermedizinische Pharmabranche bewegt sich meist im Schatten der Humanmedizin, doch wenn es um die Zulassung von Medikamenten, die Tiere helfen, geht, folgt sie oft einem heimlichen und bemerkenswerten Schnellverfahren. Während die Entwicklung und Zulassung von Humanarzneimitteln Jahre, mitunter sogar über ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen und hunderte Millionen bis Milliarden Dollar kosten, sind Tierarzneimittel häufig schon in der Hälfte der Zeit und mit einem Bruchteil des Budgets zugelassen. Dieses Phänomen wirft Fragen auf: Wie funktioniert dieser beschleunigte Weg? Welche Chancen bietet er für die Zukunft sowohl der Tier- als auch der Humanmedizin? Und warum erscheint dieser Weg für Menschenmedizin noch nicht greifbar? Um diese Fragen zu verstehen, muss man sich zunächst mit den regulatorischen Grundlagen beschäftigen, die hinter der Zulassung von Tierarzneimitteln stehen. In den Vereinigten Staaten übernimmt die Food and Drug Administration (FDA) nicht nur die Kontrolle von Humanarzneimitteln, sondern ist auch für Tierarzneimittel zuständig, genauer gesagt über eine spezielle Abteilung namens Center for Veterinary Medicine (CVM). Ähnlich verfährt auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) in Europa.
Die Maßstäbe für Sicherheit, Wirksamkeit und Haltbarkeit, die hier angelegt werden, sind grundsätzlich ähnlich denen der Humanmedizin – doch wie die Praxis zeigt, unterscheidet sich die Zeitachse und der Kostenaufwand erheblich. Das Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel umfasst wie bei Humanmedikamenten eine Reihe von Studienphasen. Dazu zählen kleine Sicherheitsprüfungen an gesunden Tieren, Feldstudien mit kranken Tieren zur Überprüfung der Wirksamkeit sowie größere Untersuchungen zur Bestätigung der Ergebnisse. Allerdings sind Kosten und Dauer für Tierarzneimittel deutlich reduziert. Dies liegt zum Teil daran, dass die Grünen lichtschalter schon auf Erfahrungen aus der Humanmedizin zurückgreifen können, zum anderen an der Größe und Komplexität der durchgeführten Studien.
Ein Sicherheits- oder Wirksamkeitsversuch bei Tieren kostet typischerweise mehrere Millionen Dollar und dauert mehrere Jahre, was natürlich immer noch ein beträchtliches Investment ist. Doch im Vergleich zu Humanstudien, die bis zu zehnfach höhere Kosten und doppelt so lange Zeit erfordern, ist dies verhältnismäßig schnell. Eine entscheidende Ursache für diesen Unterschied ist, dass Regulierungsbehörden bei Tierarzneimitteln bereit sind, höhere Risiken bezüglich der Wirksamkeit einzugehen, während die Sicherheit weiterhin streng geprüft wird. Die Tatsache, dass ein Tier neben dem Menschenexistieren kann und dass Tierschutzgesetze eine andere Gewichtung als ethische Überlegungen bei Menschen aufweisen, ermöglicht es, einen pragmatischeren Ansatz zu verfolgen. So ist es theoretisch akzeptabel, ein Tierarzneimittel auf den Markt zu bringen, bei dem die Evidenz für die Wirksamkeit zunächst nicht vollständig gesichert ist, solange keine erheblichen Sicherheitsbedenken bestehen.
Eine besondere Rolle nimmt hierbei das Gesetz über „Minor Uses and Minor Species“ (MUMS) ein, das 2004 in den USA eingeführt wurde, um die Entwicklung von Medikamenten für seltene Tierarten oder seltene Erkrankungen bei Tieren zu fördern. Das MUMS-Gesetz bietet ähnliche Anreize wie das bekannte „Orphan Drug Act“ für seltene menschliche Erkrankungen, darunter die Verlängerung von Marktexklusivität, Steuervergünstigungen und vor allem ein beschleunigtes Zulassungsverfahren durch eine gesenkte Hürde bei der Nachweispflicht zur Wirksamkeit. Während das Orphan-Drug-Gesetz zwar ebenfalls eine beschleunigte Zulassung ermöglicht, verlangt es doch meist robuste Nachweise durch klinische Studien oder zumindest durch aussagekräftige surrogate Endpunkte. Das MUMS-Gesetz geht hier weiter: Es ermöglicht die Zulassung von Tierarzneimitteln auf Basis einer „vernünftigen Erwartung der Wirksamkeit“. Das bedeutet beispielsweise, dass eine umfassende Literaturübersicht oder vergleichbare evidenzbasierte Indizien als ausreichend gelten können, um die Zulassung voranzutreiben, ohne dass großangelegte Wirksamkeitsstudien bereits vorliegen müssen.
Dadurch kann das Medikation schneller auf den Markt gebracht werden und wichtige Anwendungen, die sonst aufgrund der hohen Kosten und geringer Marktaussichten ignoriert würden, erhalten eine Chance. Ein weiteres wesentliches Instrument stellt die erweiterte bedingte Zulassung (Expanded Conditional Approval, XCA) dar, die seit 2018 im Zusammenhang mit dem MUMS-Gesetz besteht. Diese Erweiterung erlaubt es, auch für größere Tierarten und bedeutendere Anwendungsgebiete, bei denen herkömmliche Studien zu teuer oder komplex sind, den Umweg über die „vernünftige Erwartung“ der Wirksamkeit zu gehen. Dadurch sind nun auch Erkrankungen bei Haustieren wie Katzen und Hunden, die bislang nur schwer adressierbar waren, über XCA erreichbar. Beispiele dafür sind chronische Krankheiten wie Nierenleiden bei Katzen oder altersbedingte Leiden bei Hunden.
Die Firma Loyal, die sich auf Langlebigkeitsmedikamente für Hunde spezialisiert hat, nutzte diesen schnellen Weg, um ein neuartiges Präparat auf den Markt zu bringen, ohne eine herkömmliche, langwierige Wirksamkeitsstudie durchführen zu müssen. Sie überzeugte die Behörden mithilfe umfangreicher Studien, die zwar nicht als vollständige klinische Wirksamkeit gelten, aber als ausreichende rationale Grundlage, um so genannte Biomarker zu nutzen, die mit Alterungsprozessen korrelieren. Dadurch konnten sie einen millionenschweren, jahrelangen Versuch umgehen und ihr Produkt innerhalb von 18 Monaten zu wesentlich geringeren Kosten in den Umlauf bringen. Das ermöglicht nicht nur schnelles Feedback aus der realen Anwendung, sondern verkürzt auch den Zeitraum, bis das Medikament Einnahmen generiert. Während dieser Mechanismus aus tierärztlicher Sicht ein großer Fortschritt ist, bleibt eine direkte Übertragung dieses Zulassungsmodells auf die Humanmedizin noch Zukunftsmusik.
Zwar gibt es im menschlichen Bereich Wege wie die sogenannte beschleunigte Zulassung (Accelerated Approval), die surrogatbasierte Endpunkte zulassen, jedoch sind dort die Anforderungen an die Evidenz und an die weitere Nachverfolgung strikt. Zum Beispiel muss ein biomarkerbasierter Nutzen recht robust mit einem klinischen Benefit korrelieren, und Studien zur Wirksamkeit am Patienten müssen zwingend nachgereicht werden. Ein zu lockerer Zulassungsstandard würde hier gegen ethische und rechtliche Vorgaben verstoßen. Sollte es jedoch in der Humanmedizin einen ähnlichen Weg wie XCA geben – beispielsweise eine „erweiterte beschleunigte Zulassung“ – könnte dies die pharmazeutische Forschung revolutionieren. Mehr Unternehmen könnten sich an der Entwicklung neuer Therapien für komplexe, chronische Erkrankungen versuchen, da der Kosten- und Zeitaufwand für die erste Zulassung deutlich sinken würde.
Auch die Vielfalt der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten könnte dadurch steigen, denn seltene Patientensubgruppen, die mit aktuellen Therapien wenig profitieren, könnten gezielter erreicht werden. Dadurch könnte die heutige Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder chronischer Niereninsuffizienz einen Quantensprung erfahren. Natürlich würde ein solcher Weg auch Risiken bergen. Die Patienten und Ärzte müssten ein deutlich höheres Maß an Eigenverantwortung übernehmen, da viele Medikamente zunächst nicht vollständig validiert wären. Zudem müssten die Aufsichtsbehörden ihre Kapazitäten für das Monitoring von Nachstudien stärken, um ineffektive oder unsichere Medikamente möglichst rasch vom Markt nehmen zu können.
Gleichzeitig würde ein breiteres Angebot an günstigeren Therapien entstehen, denn geringere Zulassungskosten können übersetzt auf kostengünstigere Arzneimittelpreise. Die tiermedizinische Branche dient somit als stiller Vorreiter für ein mutiges Zulassungsmodell, das Potenziale birgt, die auch für die Humanmedizin spannend sind. Der geheime Schnellweg der Tierarzneimittel zeigt, dass Vertrauen in evidenzbasierte, aber pragmatische Zulassungsverfahren Innovationen fördert und damit letztlich Lebensqualität verbessert. Die Herausforderung besteht nun darin, das Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Wirksamkeit und Geschwindigkeit in der Humanmedizin besser zu justieren, ohne dabei den Schutz der Patienten aufs Spiel zu setzen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die schnelleren, kostengünstigeren Zulassungswege für Tierarzneimittel nicht nur den Tieren zugutekommen, sondern auch als Blaupause für zukünftige Innovationen in der Humanmedizin dienen können.
Indem man bewährte Konzepte wie die MUMS-Expansion und die erweiterte bedingte Zulassung näher betrachtet und auf menschliche Bedingungen anpasst, könnte ein neuer Zulassungsansatz entstehen, der den Herausforderungen chronischer und seltener Krankheiten besser gerecht wird. Eine solche Entwicklung könnte den Weg ebnen für eine bessere Versorgung von Patienten weltweit – ganz im Sinne eines zeitgemäßen, patientenzentrierten Medizinverständnisses.