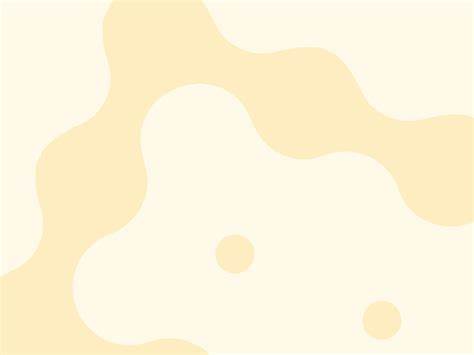Die Wissenschaft ist stets im Wandel begriffen. Neue Technologien, sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse und aufkommende globale Herausforderungen zwingen Forschende dazu, ihre Arbeit immer wieder neu auszurichten. Doch trotz der offensichtlichen Vorteile von Innovation und Forschung in neuen Bereichen zeigt die empirische Realität, dass große Wechsel in der Forschung oftmals mit erheblichen Einbußen einhergehen. Dieses Phänomen wird als „Pivot-Strafe“ bezeichnet und beschreibt, wie sich die Wirkung wissenschaftlicher Arbeiten und Patente verschlechtert, je weiter Forscher von ihren bisherigen Fachgebieten abweichen. Der Begriff „Pivot“ beschreibt in diesem Kontext die Bewegung eines Wissenschaftlers oder Erfinders in ein neues Forschungsgebiet.
Dabei ist der Grad des Pivots variabel: Von kleinen Anpassungen innerhalb verwandter Themen bis zu radikalen Wechseln in völlig neue Disziplinen. Eine umfassende Studie, veröffentlicht im renommierten Fachjournal Nature, hat Millionen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Patenten analysiert, um diese Bewegungen quantitativ zu erfassen und zu bewerten. Die Ergebnisse offenbaren einen systematischen negativen Zusammenhang zwischen der Größe des Pivots und dessen Erfolg. Der Erfolg einer wissenschaftlichen Arbeit oder einer Erfindung wird üblicherweise anhand der Zitationen oder Marktauswirkungen gemessen. Zitationen zeigen, wie oft eine Arbeit von anderen Forschenden aufgegriffen wird und gelten als Indikator für Relevanz und Einfluss.
Die Analyse zeigte, dass je größer der Sprung in ein neues Gebiet, desto geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Arbeit zu den meistzitierten oder einflussreichsten zählt. Besonders hervorzuheben ist, dass diese sogenannte Pivot-Strafe nicht nur in der reinen Wissenschaft auftritt, sondern auch in der technologischen Innovation, belegt durch geringe Zitationen von Patenten und reduzierte Marktwerte. Die Messung des Pivots erfolgte durch ein eigens entwickeltes Framework, das die Ähnlichkeit zwischen der neuen Arbeit eines Forschers und seinen bisherigen Veröffentlichungen oder Patenten bewertet. Hierzu wurde eine Cosinus-Ähnlichkeitsmetrik genutzt, die den Anteil gemeinsamer Bezugspunkte – wie beispielsweise Zitierungen gemeinsamer Fachzeitschriften oder patentbezogene Technologiefelder – misst. Je kleiner die Ähnlichkeit, desto größer der Pivot.
Das Spannende an diesem Ansatz ist, dass er eine kontinuierliche Skala von 0 bis 1 bietet, auf der 0 völlige Kontinuität und 1 eine komplette Neuausrichtung bedeutet. Die Folgen eines solchen Pivots sind vielfältig. Neben einem deutlichen Rückgang der Zitationshäufigkeit fand man auch niedrigere Erfolgsquoten bei der Veröffentlichung von Preprints sowie weniger wertstiftende Patentbewertungen anhand von Marktreaktionen. Ein Blick auf die zeitliche Entwicklung zeigt, dass die Pivot-Strafe in den letzten fünfzig Jahren sogar zugenommen hat, was auf eine wachsende Spezialisierung und zunehmende Komplexität der Wissensgebiete schließen lässt. Doch warum existiert überhaupt eine Pivot-Strafe? Die Studie untersucht verschiedene Erklärungsansätze aus der Wissenschafts- und Innovationsforschung.
Ein wichtiger Faktor sind die etablierten Reputationseffekte innerhalb einer Fachgemeinschaft. Forschende genießen innerhalb ihres bekannten Fachgebiets Anerkennung, die ihnen wiederum hilft, ihre Arbeiten zu platzieren und anerkannt zu bekommen. Wird jedoch ein neues Gebiet betreten, fehlt diese Reputation, und die Arbeit stößt auf weniger Akzeptanz. Dies wird durch das Konzept des „Typecasting“ beschrieben, bei dem eine Forschungs- oder Expertise-Identität die Wahrnehmung durch andere beeinflusst. Neben der Reputationsfrage spielt auch die kreative Fähigkeit eine entscheidende Rolle.
Der „Explore versus Exploit“-Ansatz beschreibt den Konflikt zwischen der Ausnutzung bekannter Forschungsthemen und der Erforschung neuer, riskanterer Felder. Obwohl Exploration potenziell große Durchbrüche ermöglicht, ist sie meist mit hohen Wissenslücken verbunden. Die Untersuchung zeigt überraschenderweise, dass gerade extrem innovative Arbeiten durch große Pivots eher unterrepräsentiert sind, was darauf hindeutet, dass tiefgehendes Spezialwissen für das Generieren einflussreicher Forschung oft unersetzlich bleibt. Diese Erkenntnis wird durch weitere Analysen gestützt, die zeigen, dass hoch pivotierende Arbeiten zwar ungewöhnliche Wissenskombinationen aufweisen, gleichzeitig aber weniger konventionelle und etablierte Wissensbestandteile enthalten. Dies könnte ein Grund für ihre geringere Wirkung sein, da eine solide Verankerung in bewährtem Wissen offenbar erforderlich ist, um Innovationen erfolgreich zu kommunizieren und anzuwenden.
Extremereignisse wie die COVID-19-Pandemie haben ebenfalls einen starken Einfluss auf die Pivot-Dynamik. Viele Forschende wechselten in kürzester Zeit in die Erforschung der Pandemie, was einen enormen Pivot darstellt. Trotz eines kommerziellen und wissenschaftlichen „Impact-Premiums“ für COVID-19-bezogene Publikationen blieb die Pivot-Strafe bestehen – auch diese Arbeiten litten unter einem geringeren Einfluss im Vergleich zu weniger pivotierenden Studien. Dies unterstreicht die strukturellen Schwierigkeiten, mit denen Forschungssysteme bei schnellen Änderungen konfrontiert sind. Auch externe Schocks, etwa das Zurückziehen oder Korrigieren von wissenschaftlichen Ergebnissen durch Retraction, führen dazu, dass Forschende gezwungen sind, ihre Arbeit neu auszurichten.
In solchen Fällen steigt die Größe des Pivots ebenso wie die Wahrscheinlichkeit für eine reduzierte Wirkung der Folgearbeiten. Die Studie bestätigt somit, dass sowohl push- als auch pull-Faktoren für einen Wechsel in neue Gebiete mit messbaren Kosten verbunden sind. Die Erkenntnisse der Pivot-Strafe werfen weitreichende Fragen für Wissenschaftspolitik, Forschungsmanagement und die strategische Planung in Forschungseinrichtungen auf. Insbesondere da Wissenschaft immer interdisziplinärer wird und dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie Klima, Gesundheit und künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen Disziplinen aufbrechen, tritt die Notwendigkeit hervor, Anpassungsfähigkeiten zu fördern. Die zunehmende Spezialisierung und die Pivot-Strafe zeigen jedoch, dass reine Erwartungshaltungen an einzelne Forschende zur flexiblen Neuausrichtung oft unrealistisch sind.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, empfiehlt sich eine diversifizierte strategische Personalpolitik. Investitionen in vielfältige Forschungsteams, die unterschiedliche Expertise bündeln, fördern die Fähigkeit eines Instituts oder einer Organisation, neue Felder zu besetzen und dennoch eine kritische Masse an Wissen und Reputation zu halten. Auch „Acquihires“, also gezielte Anstellungen von Expertinnen und Experten aus neuen Bereichen, können den Adaptionsprozess abkürzen und so die negativen Effekte großer Pivots abmildern. Ebenso wichtig sind fördernde Rahmenbedingungen in der Wissenschaftspolitik, die es Forschenden ermöglichen, risikoärmere Erkundungen neuer Gebiete durchzuführen, möglicherweise mit angepassten Bewertungsmaßstäben, die Innovationen erlösen, auch wenn sie nicht sofort hohe Zitationen erzielen. Die Förderung langfristiger Forschungsprojekte und interdisziplinärer Kollaborationen kann die Wissensintegration erleichtern, welche für erfolgreiche Pivots nötig ist.
Die Pivot-Strafe zeigt also, dass der Übergang in neue Forschungsgebiete mit klaren Hindernissen behaftet ist, die weit über individuelle Fähigkeiten hinausgehen. Strukturelle Faktoren wie Bewertungssysteme, Fachkulturen und institutionelle Mechanismen beeinflussen maßgeblich die Chancen, mit neuen Themen erfolgreich zu sein. Die Fortentwicklung der Wissenschaft hängt daher nicht nur von der Erfindungskraft Einzelner ab, sondern auch von der Gestaltung eines unterstützenden Innovationsökosystems. Darüber hinaus bietet das Verständnis der Pivot-Strafe auch wertvolle Einsichten für andere soziale und wirtschaftliche Systeme. Beispielsweise stehen Unternehmen, Regionen und sogar ganze Volkswirtschaften vor ähnlichen Herausforderungen bei der Anpassung an neue technologische oder marktliche Bedingungen.
Die Erkenntnisse, dass Pivots hohen Risiken und potenziellen Einbußen ausgesetzt sind, können als Leitlinie für Innovationsstrategien dienen – mit dem Fokus auf diversifizierte Portfolios und gezielte Förderung von Spezialwissen, um nachhaltigen Wandel zu realisieren. Abschließend bleibt zu sagen, dass der weitere Forschungsbedarf groß ist. Insbesondere wie sich Forscher am besten in neuen Gebieten etablieren, welche Faktoren nachhaltigen Erfolg sichern und wie Forschungssysteme weiterhin agil bleiben, sind essenzielle Fragen. Gleichzeitig zeigt die Pivot-Strafe, dass das Verständnis und die Berücksichtigung von Anpassungsbarrieren entscheidend sind, um das volle Potenzial wissenschaftlicher Anpassungsfähigkeit auszuschöpfen und so große gesellschaftliche Herausforderungen effektiver zu meistern.