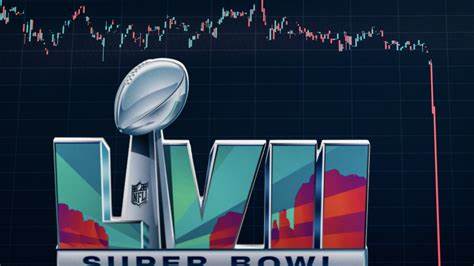Am 4. November 2020 unterzeichnete der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, erneut einen Erlass, der den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen besiegelte. Dies war kein einmaliger Schritt, sondern der finale Akt einer Politik, die seit Trumps Amtsantritt im Jahr 2016 im Mittelpunkt seiner Umweltstrategien stand. Dieser Artikel betrachtet die Hintergründe und die Auswirkungen dieses Schrittes auf das globale Klima und die internationale Zusammenarbeit im Umweltschutz. Das Pariser Klimaabkommen, das 2015 auf der COP21 in Paris verabschiedet wurde, verfolgte das ambitionierte Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen und dicke Staaten zur Emission von Treibhausgasen zu bewegen.
Das Abkommen wurde von 195 Ländern, einschließlich der USA, unterzeichnet und trat im Jahr 2016 in Kraft. Die Verpflichtung zur Reduzierung von Emissionen wurde von den meisten Nationen als ein wesentlicher Schritt zur Bekämpfung des Klimawandels erkannt. Trumps Entscheidung, die USA aus dem Abkommen zurückzuziehen, war von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum einen brachte er zur Sprache, dass das Abkommen die amerikanische Wirtschaft belasten und Arbeitsplätze gefährden würde, insbesondere im Energiesektor. Viele seiner Anhänger und das republikanische Establishment sahen im Klimawandel weniger eine Bedrohung als eine Übertreibung von Umweltschützern.
Daher wurde argumentiert, dass eine Rückkehr zur Kohlenstoffwirtschaft der Weg zu wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand sei. Die Folgen des Rückzugs aus dem Pariser Abkommen sind sowohl national als auch international spürbar. Auf der einen Seite hat dies zu einer Zunahme von CO2-Emissionen in den USA geführt, da die Regierung zahlreiche Maßnahmen zur Regulierung der Umweltstandards aufhob. Ohne die Verpflichtung zur Emissionsreduzierung schilderte die Trump-Administration eine Politik der Energieunabhängigkeit, die stark auf fossile Brennstoffe setzte. Dies führte zu einem Rückschritt in den Bemühungen um eine nachhaltigere Energiezukunft.
Auf internationaler Ebene manifestiert sich der Rückzug als eine gefährliche Entwicklung für die globale Klimapolitik. Das Vertrauen zwischen den USA und anderen Nationen wurde erschüttert, und viele Länder sahen sich gezwungen, eigene Ziele zur Emissionsreduzierung zu überdenken, da sie nicht länger auf die Unterstützung der USA setzt hatten. Länder wie Deutschland und China, die gemeinsam an der Bekämpfung des Klimawandels gearbeitet hatten, mussten nun ihre Strategien anpassen und sich auf das Fehlen einer aktiven Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten einstellen. Die Rückkehr der USA zu einer Führungsrolle im Klimaschutz scheint jetzt, da Joe Biden im Januar 2021 das Präsidentenamt übernehmen wird, unabdingbar. Biden hat bereits angekündigt, dass er die USA wieder in das Pariser Abkommen zurückführen will und eine umfassende Klimapolitik umsetzen wird.
Dies könnte zu einer Stabilisierung des internationalen Klimadiplomats führen und die Initiative für Umweltschutzmaßnahmen wiederbeleben. Die unmittelbaren Auswirkungen des Abkommens sind bereits spürbar geworden, als viele Organisationen und Aktivisten sich gegen die Trump-Administration zusammenschlugen, um den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Juristische Schritte wurden eingeleitet, um die negativen Folgen der Administration zu bekämpfen. Zudem mobilisierten sich Jugendbewegungen und Umweltschutzorganisationen in den USA und weltweit, um die Themen Klimawandel und Umweltschutz wieder in den Vordergrund zu rücken. Der Rückzug der USA aus dem Pariser Abkommen verdeutlicht nicht nur die Schwierigkeiten des Klimaschutzes in der politischen Arena, sondern auch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Bewegung von der Zivilgesellschaft.
Der Klimawandel ist ein globales Problem, das nicht an Landesgrenzen haltmacht. Wenn Nationen zusammenarbeiten und innovative Lösungen finden, kann eine positive Veränderung realisiert werden. Der Klimawandel ist auch ein wichtiges Thema für die kommenden Generationen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Verantwortung gegenüber unserem Planeten wird zunehmend notwendig. Die Zivilgesellschaft hat die Verantwortung, Stimmen zu erheben und politische Entscheidungsträger unter Druck zu setzen, um deren Handlungen und Strategien zu hinterfragen.