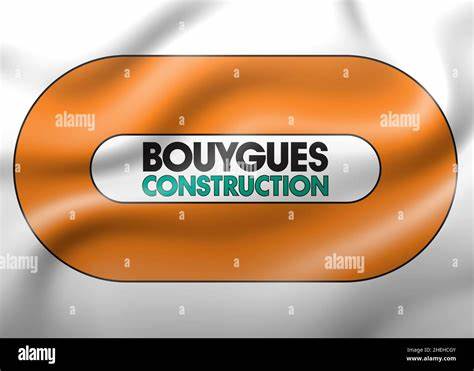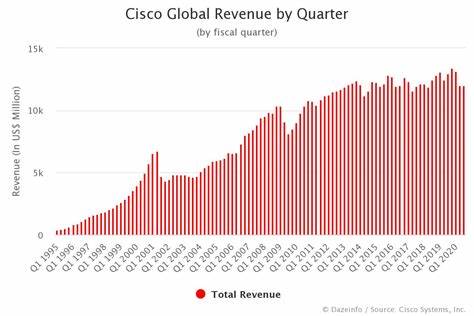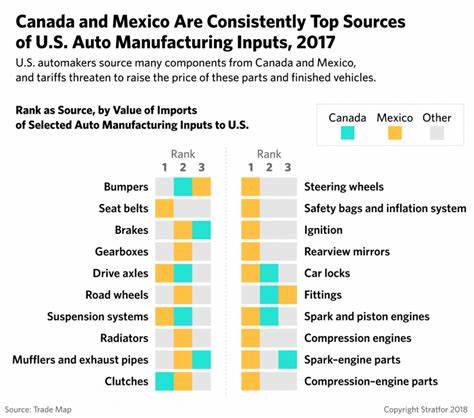Im Mai 2025 fällte der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein Urteil, das weit über den Einzelfall hinaus Bedeutung hat. Im Kern ging es um die langwierige Auseinandersetzung zwischen der EU-Kommission und der renommierten Zeitung The New York Times um den Zugang zu privaten Textnachrichten zwischen der Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, und dem CEO von Pfizer, Albert Bourla. Diese Nachrichten sollten gemeinsamen Beschaffungsverträgen zugunsten der COVID-19-Impfstoffe auf den Grund gehen. Die EU-Kommission verlor in allen Punkten, da sie dem Gericht keine glaubwürdige Erklärung liefern konnte, warum die angeforderten Dokumente nicht in ihrem Besitz seien oder wo sie geblieben sein könnten. Das Urteil wirft ein Schlaglicht auf den Umgang mit Transparenz und Dokumentenmanagement im Europäischen Exekutivorgan und steht exemplarisch für die Herausforderungen in der Pandemiezeit.
Die rechtliche Auseinandersetzung hat ihre Wurzeln in der außergewöhnlichen Beschaffungssituation zu Beginn der COVID-19-Pandemie. Die Pfizer-BioNTech-Impfstoffe waren die ersten, die im Dezember 2020 die Zulassung der EU erhielten. Bereits kurz zuvor, im November 2020, wurden Vorverträge für die Lieferung von 200 Millionen Dosen abgeschlossen, deren endgültige Verträge im März und Mai 2021 ausgeweitet wurden und sich auf einen Wert von 2,4 Milliarden Euro beliefen. Zusätzlich bestand die Option auf weitere 900 Millionen Dosen. Diese Verträge wurden in einem Rekordtempo abgeschlossen, das ebenso viel Aufmerksamkeit wie Misstrauen erregte, insbesondere bezüglich der Transparenz der Verhandlungen und der vertraglichen Bedingungen.
Die New York Times hatte im Jahr 2021 während Interviews mit Albert Bourla Hinweise auf den Austausch von Textnachrichten zwischen ihm und Ursula von der Leyen entdeckt. Diese Textnachrichten waren potenziell ein entscheidendes Dokument, um Einblicke in die konkrete Kommunikation und Entscheidungsfindung bei der Beschaffung der Impfstoffe zu erhalten. Doch die EU-Kommission verweigerte den Zugang mit der Begründung, sie besitze diese Nachrichten weder. Die Zeitung startete daraufhin eine wiederholte Anfrage, die keine zufriedenstellenden Ergebnisse brachte. Schließlich brachte sie die Angelegenheit im Januar 2023 vor den Europäischen Gerichtshof.
Das nun verkündete Urteil betont, dass die EU-Kommission keine plausiblen oder glaubwürdigen Erklärungen vorgelegt hatte, warum sie die Dokumente nicht besitze. Gemäß der EU-Verordnung von 2001 zur öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten fallen auch elektronische Nachrichten wie SMS und Textnachrichten klar unter den Begriff „Dokumente“. Das bedeutet, dass sie bei einer Anfrage aufbewahrt und herausgegeben werden müssten, sofern keine schutzwürdigen Gründe dagegen sprechen. Die Kommission hingegen scheiterte daran, nachzuweisen, dass solche Daten entweder nicht existent oder unwiederbringlich gelöscht wurden. Darüber hinaus enthielt ihre Antwort keine detaillierten Angaben zu den Suchmethoden und den Orten, an denen nach diesen Dokumenten gesucht wurde.
Es blieb unklar, ob eine Löschung absichtlich, durch technische Automatisierung oder durch einen Gerätewechsel der Präsidentin erfolgt sei. Diese juristische Niederlage berührt die grundlegende Frage der Transparenz und Rechenschaftspflicht der Europäischen Union in Zeiten einer beispiellosen Krisensituation. Die Pandemie erforderte zweifellos schnelle Entscheidungen, doch gerade solche Situationen verlangen aus demokratischer Perspektive eine sorgfältige Dokumentation und Offenlegung, damit die Öffentlichkeit und Kontrollorgane nachvollziehen können, wie und warum politische Entscheidungen getroffen wurden. Die Entscheidung des Gerichts stärkt damit die Rechte von Medien und Bürgern, Einsicht in bedeutende politische Dokumente zu erhalten, vor allem wenn es um die Verwendung öffentlicher Mittel und das Handeln der EU-Kommission geht. Die Antwort der EU-Kommission auf das Urteil war zurückhaltend, zugleich aber versicherte sie, die Entscheidung genau zu prüfen und weiteren rechtlichen Schritten nicht auszuschließen.
Sie kündigte an, in der Sache eine neue Entscheidung zu fällen, die eine detailliertere Begründung enthalten soll. Gleichzeitig unterstrich die Kommission erneut ihr Bekenntnis zur Transparenz und erklärte, dass sie innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens die Informationspflichten erfüllen werde. Kritiker sehen hierin jedoch eher ein taktisches Manöver, um weitere Verzögerungen zu erreichen und die brisanten Informationen weiter unter Verschluss zu halten. Neben der juristischen Dimension eröffnet das Pfizergate-Urteil auch eine Debatte über die interne Organisation und den Umgang mit digitalen Dokumenten innerhalb der EU-Institutionen. Im digitalen Zeitalter kommunizieren Regierungs- und Verwaltungsstellen vielfältig, oft über Messenger-Dienste, E-Mails oder ähnliche Tools.
Das wirft komplexe Probleme hinsichtlich der Archivierung und Zugänglichkeit solcher Dokumente auf. Das Gericht stellte klar, dass solch informelle Kommunikationswege keinesfalls von der Dokumentationspflicht ausgeschlossen sind. Die EU-Kommission steht damit vor der Herausforderung, ihre Datenmanagementprozesse zu modernisieren und durchzusetzen, um gerichtlichen und demokratischen Kontrollansprüchen gerecht zu werden. Die Berichterstattung der New York Times und der juristische Kampf haben zudem erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung von Transparenz und Verantwortlichkeit der EU. Gerade in der Krisenmanagementphase der Pandemie waren EU-Bürger und Mitgliedsstaaten auf verlässliche und gegenüber Kontrollinstanzen offene Informationen angewiesen.
Die umfangreichen Impfstoffbeschaffungsverträge waren für viele ein undurchdringlicher Bereich, der spekulative Verschwörungstheorien und Misstrauen befeuert hatte. Das Urteil könnte als Weckruf verstanden werden, mehr Offenheit zu schaffen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in EU-Institutionen zu stärken. Gleichzeitig verdeutlicht der Fall die schwierigen juristischen und administrativen Grenzen, die der EU-Kommission bei der Informationsweitergabe gesetzt sind. Datenschutz, geschäftliche Vertraulichkeit und internationale Vereinbarungen begrenzen oftmals die Offenlegung umfassender Dokumente. Dennoch zeigt der EuGH, dass diese Schranken die Verpflichtung zur umfassenden und nachvollziehbaren Begründung im Falle einer Verweigerung nicht aufheben.
Die Rechtsprechung dieses Falls wird daher voraussichtlich weitreichende Folgen für zukünftige Anfragen zu sensiblen Dokumenten im politisch-administrativen Kontext haben. Nicht zuletzt hinterlässt die öffentliche Auseinandersetzung um die Pfizer-Verträge auch Spuren in der politischen Debatte Europas. Politiker, Aktivisten und Experten fordern bereits seit längerem mehr Transparenz bei der Beschaffung und eine Verbesserung der Kommunikationspolitik gegenüber den Bürgern. Die Pandemie hat die Verwundbarkeit des Systems offenbart und zugleich die Chancen digitaler Informationsflüsse verdeutlicht. Das aktuelle Urteil stellt diese Forderungen in einen neuen rechtlichen Rahmen und macht den Druck auf die EU-Kommission spürbar, sich klarer und offener zu zeigen.
In Summe steht der Pfizergate-Rechtsstreit nicht nur für den Kampf eines Mediums um Informationsfreiheit, sondern für eine grundlegende demokratische Frage: Wie kann und soll eine supranationale Institution wie die EU in Krisenzeiten transparent und rechenschaftspflichtig handeln? Die Gerichtsentscheidung des EuGH sendet ein starkes Signal an die EU-Kommission und die gesamte politische Verwaltung in Europa. Sie fordert nicht nur eine bessere Dokumentenverwaltung und Nachvollziehbarkeit, sondern auch eine Kultur des offenen Umgangs mit schwierigen Fragen. Angesichts der bevorstehenden weiteren juristischen Schritte bleibt die Entwicklung in diesem Fall spannend – und wegweisend für die Zukunft der europäischen Demokratie und ihre Vertrauensbildung.