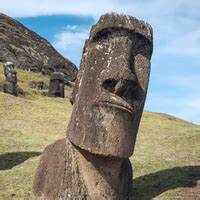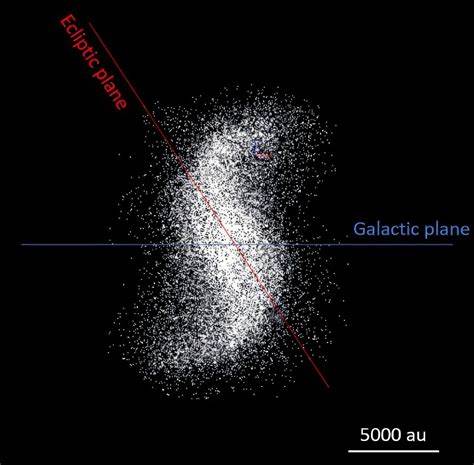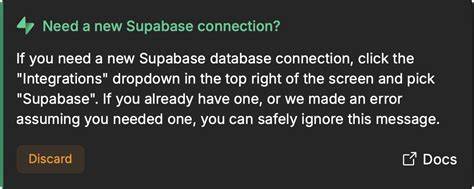Die Entwicklung moderner molekularbiologischer Werkzeuge hat die biomedizinische Forschung revolutioniert. Insbesondere Systeme, die auf RNA-gesteuerten Endonukleasen basieren, haben enorme Möglichkeiten eröffnet, um komplexe genetische und epigenetische Fragestellungen zu adressieren. Im Zentrum dieser Innovationen steht die evolutionär optimierte Proteinstruktur des IscB-Endonuklease-Systems, das sich aufgrund seiner kompakten Größe und Funktionalität als vielversprechendes Werkzeug für die epigenetische Modifikation im lebenden Organismus herausgestellt hat. Die anhaltenden Herausforderungen in der Gen- und Epigenombearbeitung betreffen neben der Effizienz insbesondere die Spezifität und die Fähigkeit, die Werkzeuge sicher und dauerhaft in vivo anzuwenden. Hier kommt das evolutionär geleitete Proteindesign von IscB ins Spiel, welches durch orthologes Screening, strukturbasiertes Engineering und RNA-Optimierung verbesserte Varianten erzeugt, die eine nachhaltige Epigenombearbeitung ermöglichen.
IscB ist ein kleiner RNA-gesteuerter Endonuklease, der zu der OMEGA (Obligate Mobile Element Guided Activity) Klasse gehört und als evolutionärer Vorläufer der bekannten Cas9-Systeme gilt. Mit einer Länge von nur etwa 300 bis 550 Aminosäuren ist IscB deutlich kompakter als herkömmliche Cas9-Proteine und daher besonders geeignet für die Verpackung in limitierte Vektoren wie adeno-assoziierte Viren (AAV), die entscheidend für die in vivo Verabreichung sind. Diese geringe Größe bietet den Vorteil, dass neben der Nuklease auch funktionelle Domänen wie Methyltransferasen oder Repressoren eingebaut werden können, um eine gezielte Genregulation über epigenetische Modifikationen zu realisieren. Eine zentrale Herausforderung bei der Nutzung von IscB als Genomeditor ist die vergleichsweise kurze effektive Länge der Guide-RNA, die das System für seine Ziel-DNA-Sequenzen benötigt, um eine hohe Spezifität und Aktivität zu gewährleisten. Während gängige Systeme wie SpCas9 mit Guides von etwa 17 bis 20 Nukleotiden arbeiten und dadurch eine hohe Zielgenauigkeit besitzen, arbeitet das wildtypische IscB häufig mit kürzeren Guides von rund 13 bis 15 Nukleotiden, was das Risiko von Off-Target-Effekten erhöht.
Um diese Einschränkung zu überwinden, kombinierte das Team aus Forschern orthologes Screening zahlreicher IscB-Varianten mit evolutionär inspiriertem Protein-Design. Im Rahmen dieses fortgeschrittenen Engineering-Prozesses wurde eine IscB-Variante namens NovaIscB entwickelt. Dieses künstlich optimierte Protein enthält eine eingefügte REK-Domäne (Recognition domain), welche ursprünglich aus verwandten Cas9-Proteinen stammt. Durch vergleichende strukturelle Modellierung mit AlphaFold2 und anschließende experimentelle Bestätigung konnte gezeigt werden, dass diese REC-Domäne die Interaktion von IscB mit dem RNA-DNA-Heteroduplex am Zielort verbessert. Dies führte zu einer Verlängerung der effektiven Guide-RNA-Länge auf bis zu 20 Nukleotide, was die Spezifität und Effizienz signifikant steigerte.
Die Rekonfiguration der REC-Domäne erfolgte dabei nicht nur durch Einspritzung eines kompletten Bereiches, sondern auch mittels loopspezifischer Sequenztauschungen (loop swaps), um die Bindungs- und Steuereigenschaften weiter zu verfeinern. Kristallographische und Kryo-Elektronenmikroskopische Strukturanalysen bestätigten, dass die eingefügte REC-Domäne durch hydrophobe Wechselwirkungen den Guide-Target-Heteroduplex stabilisiert und somit eine genauere Prüfung von Sekundärstrukturen und Fehlpaarungen ermöglicht. Die präzise Anordnung der katalytischen Domänen HNH und RuvC wurde zusätzlich verbessert, was die Aktivität des Enzyms verstärkte ohne dabei die Spezifität zu beeinträchtigen. Parallel zur Proteindesign-Optimierung wurde auch das zugrunde liegende ωRNA-Derivat des IscB-Systems einer Struktur- und Funktionsanalyse unterzogen. Durch sogenannte Struktur-geführte RNA-Trunkierungen konnte die Länge des ωRNA-Scaffolds reduziert werden, ohne die Leistungsfähigkeit einzuschränken.
Eine deutlich kürzere ωRNA begünstigt nicht nur die stabilere Expression in Zellen, sondern auch die effiziente synthetische Herstellung und damit die universelle Einsetzbarkeit in unterschiedlichen Anwendungskontexten, etwa bei der RNA-basierten Zustellung. Auf Basis dieser durchdachten Protein- und RNA-Modifikationen entstand eine skalierbare Plattform, die sich mit verschiedenen funktionalen Domänen kombinieren lässt. Ein besonders interessantes Beispiel ist die Fusion von NovaIscB mit DNA-Methyltransferasen (Dnmt3A, Dnmt3L) und repressiven Domänen wie KRAB, die gemeinsam als „OMEGAoff“ bezeichnet wird. Dieses Konstrukt ermöglicht eine präzise und anhaltende Transkriptionsrepression durch epigenetische Modifikationen von Zielgenen, ohne dabei direkte DNA-Doppelstrangbrüche zu erzeugen. Das ist ein wesentlicher Sicherheitsvorteil gegenüber herkömmlichen Nukleasen-basierten Editoren.
Durch die kompakte Größe von NovaIscB inklusive ωRNA kann OMEGAoff in einem einzigen AAV-Vektor verpackt und effizient in lebende Organismen eingebracht werden. In präklinischen Mausmodellen wurde die zielgerichtete Repression von PCSK9, einem für Cholesterinspiegel relevanten Gen, mittels intravenöser AAV-Verabreichung demonstriert. Die beobachtete Genunterdrückung hielt über einen Zeitraum von sechs Monaten an, begleitet von einer signifikanten Absenkung des Serum-Cholesterinspiegels und ohne erkennbare hepatische Toxizität. Darüber hinaus wurde die hohe Präzision und Sicherheit von NovaIscB gegenüber Off-Target-Modifikationen mittels Tagmentation-basierter Tag-Insertions-Sequenzierung (TTISS) bestätigt. Das System zeigte bei Vergleich zu anderen kompakten Genomeditoren wie AsCas12f–YHAM und optimierten OgeuIscB-Varianten eine bessere Balance aus Aktivität und Spezifität.
Damit eröffnet NovaIscB neue konsistente Möglichkeiten für therapeutisch relevante Epigenombearbeitungsstrategien. Ein weiterer Vorteil des IscB-Systems ist seine phylogenetische Herkunft aus humanen Mikrobiomen, insbesondere aus Darmmetagenomen, was potenziell mit einer geringeren Immunogenität im menschlichen Körper einhergehen könnte. Dies ist von hoher Bedeutung für Anwendungen im klinischen Umfeld, bei denen immunologische Reaktionen auf bakterielle Nukleasen häufig problematisch sind. Die evolutionär geleitete Herangehensweise kombiniert das Wissen aus natürlicher Proteinvielfalt mit modernen Methoden der Strukturvorhersage und rationalem Design. Sie demonstriert, wie gezielte Einschnitte in die Proteinarchitektur bestehender Enzyme deren biotechnologische Eigenschaften verbessern können.
Die erfolgreiche Erweiterung der effektiven Guide-Länge via REC-Domänen-Einbau und Loop-Rekombinationen bietet ein Vorbild, wie Spezifitätsdefizite kompakter RNA-gesteuerter Editoren überwunden werden können. Zukunftsperspektivisch besteht großes Potenzial, das IscB-System durch weitere Forschung und Entwicklung auszubauen. Die Öffnung und Erweiterung der Zielsequenzpräferenzen (TAM/PAM) mittels weiteren Engineerings könnte die Flexibilität für viele genomische Positionen erhöhen. Auch die Integration zusätzlicher funktionaler Domänen für andere molekulare Anwendungen wie Basen- und Prime-Editing oder RNA-Modifikationen ist denkbar. Die Kombination der Innovationskraft evolutionär geführter Proteinengineering-Strategien mit den einzigartigen Eigenschaften des IscB-Systems liefert eine starke Basis für sichere, effiziente und dauerhafte Epigenombearbeitung in vivo.
Diese Technologie verspricht, die genetische Medizin und Grundlagenforschung entscheidend voranzutreiben und neue Therapien für bislang schwer behandelbare Krankheiten zu ermöglichen.