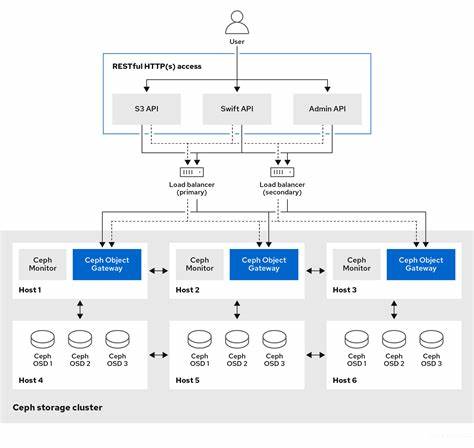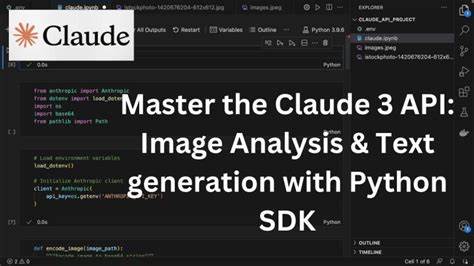Die Tiefsee, insbesondere die abyssale Zone, die sich unterhalb von 5.000 Metern Tiefe erstreckt, galt lange Zeit als ein Bereich mit nur geringfügiger biologischer und geochemischer Aktivität. Doch aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen enthüllen ein anderes Bild: Diese tiefsten Regionen der Ozeane sind aktiv in die biogeochemischen Kreisläufe von Spurenelementen eingebunden und steuern entscheidend deren Verteilung und Transformation im marinen Ökosystem. Spurenelemente wie seltene Erden, Neodym, Eisen, Mangan und zahlreiche andere Metalle sind für das marine Leben essentiell und dienen gleichzeitig als wichtige Indikatoren für ozeanische Prozesse – von der Wasserzirkulation bis hin zur Klimaentwicklung. Grundlegend für das Verständnis der Rolle der abyssalen Tiefsee im Spurenelementkreislauf sind die Mechanismen des Partikel-Scavengings und der sogenannten Sediment-Wasser-Grenzflächenaustausch-Prozesse.
Traditionell wurde angenommen, dass diese Spurenelemente vor allem im Wasserkörper kontrolliert werden – sie binden sich reversibel an Teilchen, und durch einen Abwärts-Transport in Form von biologisch erzeugtem Material werden sie zu größeren Tiefen befördert. Dieses Modell, als „top-down“-Ansatz bezeichnet, fokussiert auf biogene Partikel und deren Verfall im Wassersäulenprofil als Haupttriebkraft der Elementverteilung. Jedoch widersprechen neuere Beobachtungen zunehmend diesem klassischen Modell. So zeigen Messungen von seltenen Erden und Neodym-Isotopen, dass Sedimente am Meeresboden eine starke und direkte Prägung auf die chemische Zusammensetzung des Wassers ausüben. Dieser „bottom-up“-Ansatz hebt hervor, dass Sedimentdurchmischung, Diagenese und Benthol-assoziierte Prozesse maßgeblich zur Erhaltung oder Veränderung von Spurenelementen im Ozean beitragen.
Besonders die Überreste von Mangan- und Eisenoxidmineralien in den Sedimenten spielen hierbei eine entscheidende Rolle als Träger und Regulator dieser Metalle. Analysen von Tiefseesedimenten im zentralen Pazifik und entsprechenden Wasserproben verdeutlichen, dass seltene Erden überwiegend an authigenen manganbasierten Oxiden gebunden sind. Biogene Partikel wie Kalk oder Opal spielen im tiefen Ozean dagegen eine untergeordnete Rolle. Trotz der vergleichsweise geringen Masse dieser Minerale bilden sie ein hochwirksames Scavenger-System, das Spurenelemente bindet und in die Sedimente transportiert. Parallel dazu beobachtet man in den Sedimentporenwässern eine Anreicherung dieser Elemente im Vergleich zum darüber liegenden Meerwasser.
Dieser Befund weist auf einen diffusen Benthic-Flux hin, bei dem Elemente durch diagenetische Prozesse aus den Sedimenten zurück ins Wasser freigesetzt werden. Mechanistisch lassen sich diese Prozesse mit Hilfe reaktiver Transportmodelle erklären. Während organisches Material in den Sedimenten abgebaut wird, verändert sich die chemische Umwelt im Porenwasser, insbesondere der pH-Wert und die Konzentration organischer Liganden. Diese Veränderungen beeinflussen die Sorptionseigenschaften der oxidischen Mineralphasen und führen zur Freisetzung der zuvor gebundenen Spurenelemente. Diese Rückführung ins Wasser ist ein integraler Bestandteil des biogeochemischen Kreislaufs und stellt eine bedeutende Quelle in tiefen Wasserkörpern dar.
Die abyssale Topographie spielt hier eine weitere Rolle: Durch die enorme Oberfläche im Verhältnis zum Wasserraum und die durch die Interaktion interner Gezeiten mit dem Meeresboden verursachte starke turbulente Durchmischung entstehen Bedingungen, unter denen benthische Quellausflüsse eine verstärkte Wirkung entfalten. Diese bottom-intensified mixing genannt, sorgt dafür, dass freigesetzte Spurenelemente sich auch volumetrisch nachhaltig im Tiefenwasser verbreiten und so die Wasserchemie unterhalb von mehreren Tausend Metern prägen. Durch die Kombination hochwertiger Messdaten von seltenen Erden und Neodym-Isotopen mit 3D-Ozeanmodellen, welche diese physikalischen und biogeochemischen Prozesse abbilden, konnten Forscher erstmals den dominanten Einfluss der abyssalen Tiefsee auf die globalen Spurenelementkreisläufe demonstrieren. Modelle, die lediglich auf dem top-down-Prinzip der reversiblen Adsorption und Remineralisierung basieren, können sowohl die Tiefenprofile der Spurenelementkonzentrationen als auch deren isotopische Zusammensetzung nicht ausreichend erklären. Erst mit Einbeziehung des benthischen Flusses von Sedimenten, insbesondere der Zufuhr von neuem Material durch marine Silikatverwitterung in den Sedimenten, lassen sich diffuser als in der Vergangenheit die beobachteten Daten nachvollziehbar reproduzieren.
Der Nachweis eines neuen, „frischen“ benthischen Inputs, beispielsweise durch die Verwitterung vulkanischer Sedimentschichten längs des sogenannten Pazifischen Feuerrings, revolutioniert das Verständnis der Marinen Spurenelementbudgets. Dieser neue Input hat ein charakteristisches Neodym-Isotopensignal, das sich graduell mit der Wasserzirkulation vermischt und so für eine nicht-konservative Verteilung von isotopen Signaturen sorgt – ein Befund, der durch bisherige reine Mischungsmodelle nicht erklärbar war. Interessanterweise findet im Sediment nicht nur die Aufnahme und Freisetzung von Elementen statt, sondern auch eine Umverteilung zwischen verschiedenen mineralischen Phasen. So wandert seltene Erden mit der Zeit von Manganoxiden in phosphatreiche Authigenika, ein langsamer Prozess mit begrenztem Einfluss auf die Gesamtbilanz, der aber mineralogisch relevant ist. Diese Dynamik unterstreicht die Komplexität der benthischen biogeochemischen Prozesse, die durch ein fein abgestuftes Zusammenspiel von biologischer Aktivität, Mineralbildung und chemischem Gleichgewicht bestimmt wird.
Die Erkenntnisse aus Studien der abyssalen Tiefsee haben weitreichende Konsequenzen nicht nur für die ozeanische Chemie, sondern auch für die globale Klimaforschung. Spurenelemente wie Eisen und Kupfer sind essentielle Nährstoffe, die das Wachstum phytoplanktischer Organismen steuern und somit den Kohlenstoffkreislauf des Meeres beeinflussen. Ihre benthische Quellenkontrolle bedeutet, dass Veränderungen in den Sedimentprozessen – etwa durch Sauerstoffmangel, Temperaturänderungen oder Meeresströmungen – weitreichende Auswirkungen auf die Ökosystemfunktionen und Kohlenstoffspeicherung haben können. Zudem trägt das Verständnis der marinen Silikatverwitterung unter oxischen Bedingungen maßgeblich zur Abschätzung globaler Kohlenstoffbilanzen bei. Während Silikatverwitterung an Land als wichtiger CO2-Senkenmechanismus gilt, dürfte die marine Komponente dieser Reaktion bisher unterschätzt worden sein.
Untersuchungen legen nahe, dass die Verwitterung in abyssalen Sedimenten bedeutende Mengen CO2 fixiert, was den Ozean als langfristigen Puffer im Klimasystem stärkt. Auch hydrothermale Aktivitäten, etwa entlang mittelozeanischer Rücken, sind eng mit der Verteilung und Mobilisierung von Spurenelementen verbunden. Die durch heiße Quellen freigesetzten Metalle tragen zur Bildung von manganreichen Partikeln bei, welche wiederum wichtige Rollen als chemische Filter und Nährstoffträger im Ozean einnehmen. So ergibt sich ein komplexes Zusammenspiel von geologischen, physikalischen und biologischen Prozessen, die zusammen den biogeochemischen Status der Ozeane bestimmen. Die neue integrative Sicht verbindet top-down Vorgänge, wie den Transport und die Verarbeitung von biogenen Partikeln in der Wassersäule, mit bottom-up Prozessen, die direkt an der Sediment-Wasser-Grenzfläche wirken.
Die unterschiedliche Affinität von Spurenelementen zu verschiedenen Partikeltypen macht klar, warum manche Elemente ein stark „nährstoffähnliches“ Profil im Ozean zeigen, während andere deutlich von benthischer Signatur geprägt sind. Diese differenzierten Einsichten sollten in zukünftige ozeanbiogeochemische Modelle einfließen, um präzisere Vorhersagen der marinen Spurenelementzyklen und ihrer Reaktion auf Umweltveränderungen zu ermöglichen. Insbesondere die Berücksichtigung der abyssalen Sedimentprozesse und der direkt am Meeresboden ansetzenden biogeochemischen Reaktionen stellt einen wesentlichen Schritt zur Verbesserung unserer Modelle von Ozeantracern und Klimaprozessen dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die abyssale Tiefsee weit mehr als ein passiver Rezeptor organischen Materials oder ein Endlager für Spurenelemente ist. Sie ist ein hochdynamisches, biogeochemisches Aktivzentrum, das einen wesentlichen Beitrag zur Steuerung und zum Verständnis der marinen Spurenelementkreisläufe leistet.
Die Erkenntnisse über die Bedeutung authigener Oxidmineralien, der marine Silikatverwitterung sowie der tiefen Ozeanmischung eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung des ozeanischen Systems und dessen Entstehungsgeschichte – und sie unterstreichen den tiefgreifenden Einfluss der tiefsten Regionen der Meere auf das Leben und Klima unseres Planeten.