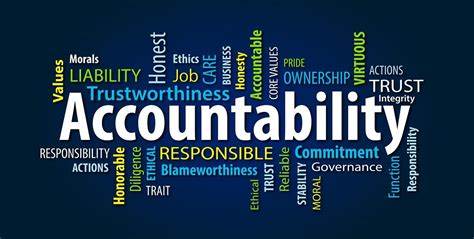Die vergangenen Wochen in Washington D.C. haben eine Debatte entfacht, die weit über politische Kreise hinaus Resonanz findet: Ein im US-Repräsentantenhaus verabschiedeter Haushaltsplan könnte das rechtliche Fundament der Technologiebranche und ihrer regulatorischen Kontrolle dramatisch verändern. Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit meist auf technologische Innovationen und deren gesellschaftliche Auswirkungen konzentriert, übersehen viele die weitreichenden juristischen Konsequenzen eines besagten Moratoriums, das für mindestens zehn Jahre die Durchsetzung staatlicher Gesetze in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und automatisierte Entscheidungssysteme einschränken soll. Diese Regelung birgt nicht nur Gefahren für die Tech-Konzerne selbst, sondern auch für die Grundpfeiler von Verbraucherrechten, Datenschutz, staatlicher Souveränität und dem stabilen Funktionieren der modernen Wirtschaft.
Die Komplexität der gesetzlichen Neuerungen verlangt eine intensive Auseinandersetzung, um die möglichen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft zu verstehen. Die Kernproblematik liegt in einer im sogenannten „Big Beautiful Bill“ verankerten Klausel, die den Bundesstaaten der USA untersagt, jegliche Gesetze durchzusetzen, die in irgendeiner Form computergestützte oder KI-basierte Entscheidungsprozesse regulieren oder einschränken. Das gilt nicht nur für speziell auf KI zugeschnittene Regelungen, sondern für so gut wie alle zivilrechtlichen Vorschriften, die mit der Nutzung eines Computers in Zusammenhang stehen. Es entsteht der Eindruck, dass mit dieser Maßnahme Technologieunternehmen für eine Dekade praktisch rechtlich unangreifbar gemacht werden, zumindest auf staatlicher Ebene, da bundesstaatliche Strafgesetze zwar vom Moratorium ausgenommen sind, zivilrechtliche Konsequenzen jedoch nahezu vollständig ausgeklammert werden. Die breite Definition des Begriffs „automatisiertes Entscheidungssystem“ ist der eigentliche Kern der Problematik.
Sie umfasst quasi jede bedeutende Nutzung eines Computers, da selbst einfache Datenanalysen oder algorithmische Entscheidungen, wie sie in zahlreichen Branchen alltäglich sind, darunter fallen. Somit erfasst das Moratorium nicht alleine High-End-KI-Anwendungen, sondern ebenso viele technische Prozesse, die bislang durch staatliche Gesetze reguliert wurden. Die Folge ist eine nahezu umfassende Prävention staatlicher Gesetzgebung in Bereichen, die von Verbraucherschutz über Datenschutz bis hin zur Durchsetzung von Vertragsrechten reichen. Eine zentrale Säule des amerikanischen Rechtssystems ist das Prinzip des Föderalismus mit klarer Kompetenzverteilung zwischen Bundes- und Staatsebene. In den USA haben die Bundesstaaten traditionell eine maßgebliche Rolle bei der Ausgestaltung und Durchsetzung zahlreicher Rechtsvorschriften, insbesondere im Zivilrecht.
Dieses System ermöglicht es den Bundesstaaten, als „Labore der Demokratie“ zu fungieren, wo innovative Gesetze ausprobiert und weiterentwickelt werden können. Das Moratorium stellt diese wesentliche Kompetenz in Frage. Mit der Einschränkung der Durchsetzung von staatlichen Zivilgesetzen wird das Prinzip der Staatsautonomie erheblich anzugreifen. Das betrifft nicht nur grundsätzliche rechtliche Prinzipien, sondern auch ganz praktisch den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern in ihrem jeweiligen Bundesstaat gegenüber unfairen Geschäftspraktiken oder technischen Missbräuchen. Von besonderer Bedeutung ist die Aufhebung staatlicher Eingriffsmöglichkeiten bei Diskriminierung durch algorithmische Systeme, die immer häufiger in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt werden, von Personalentscheidungen bis zu Kreditvergabeprozessen.
Viele Bundesstaaten haben spezifisch über die Bundesgesetze hinausgehende Regelungen erlassen, um diskriminierende Praktiken in algorithmischen Bewertungen einzudämmen. Werden diese Gesetze faktisch außer Kraft gesetzt, können Unternehmen mit Hilfe automatisierter Verfahren ungehindert diskriminieren, ohne auf zivilrechtliche Klagen oder Sanktionen vonseiten der Staaten gefasst sein zu müssen. Neben Fragen des Verbraucherschutzes sind auch Datenschutzgesetze von dem Moratorium betroffen. Da es in den USA nach wie vor kein umfassendes föderales Datenschutzgesetz gibt, spielen die Bundesstaaten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Durchsetzung von Datenschutzregeln. Gesetze wie der kalifornische California Consumer Privacy Act oder der Illinois Biometric Information Privacy Act bieten Bürgerinnen und Bürgern verbindliche Rechte im Umgang mit ihren persönlichen Daten.
Mit der Verhängung der Moratoriums auf jegliche Regelungen, die computergestützte Entscheidungsfindung betreffen, könnten diese essentiellen Schutzmechanismen entfallen. Betroffen wären zudem Bemühungen der Bundesstaaten zur Förderung technologischer Infrastruktur, etwa beim Ausbau von Breitbandinternet in ländlichen und benachteiligten Gebieten oder bei der Förderung von KI-Entwicklungen, da jegliche Fördermaßnahmen durch das Moratorium blockiert werden könnten. Dies ist besonders paradox, weil gerade diese Initiativen darauf abzielen, digitale Teilhabe zu verbessern und Innovationen zu fördern. Auf wirtschaftlicher Ebene erzeugt das Verbot erhebliche Unsicherheit. Unternehmen verlassen sich auf ein stabiles Vertragsrecht zur Absicherung ihrer Geschäftsbeziehungen.
Verträge, die computergestützte Dienste und KI-basierte Produkte betreffen, könnten durch die Blockade der Durchsetzung staatlicher Gesetze an Wirksamkeit verlieren. Das bringt beträchtliche Risiken für die Wirtschaft mit sich, da Handel und Kommunikation zunehmend digitalisiert sind. Es könnte ebenfalls zu einer Zunahme von Rechtsstreitigkeiten führen, denn die Grenzen des Moratoriums sind diffus und müssen im Zweifel durch Gerichte geklärt werden – ein langwieriger Prozess, der Investitionen und Innovationen erschwert. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die Regelung nicht nur den Verlust des reaktionsfähigen Schutzes vor neuen Formen von Betrug, Täuschung oder Diskriminierung. Auch im Bereich von Gesundheitssoftware oder digitalen Bildungsangeboten könnten verheerende Folgen auftreten.
So zeigt sich, dass bei Fehlfunktionen oder Schäden, die durch computergestützte Systeme entstehen, die Möglichkeit zum zivilrechtlichen Vorgehen gegen Verantwortliche eingeschränkt wird. Auf sozialer Ebene stellt sich die Frage nach der Schutzfunktion des Staates – wie können Bundesstaaten Kinder vor den Gefahren des Internets und missbräuchlichen Technologien schützen? Wie kann man sicherstellen, dass Überwachungstechnologien wie Gesichtserkennung einer angemessenen Kontrolle unterliegen? Diese und viele weitere Fragen bleiben durch das Moratorium unbeantwortet und offen für Missbrauch. Der Gesetzentwurf birgt eine große Gefahr, weil er nicht nur den technologischen Fortschritt beeinflussen kann, sondern auch grundlegende demokratische und rechtsstaatliche Mechanismen untergräbt. Wahlrechtsverstöße, die heute zunehmend digital stattfinden, könnten ebenso schwerer verfolgt werden. Die Einschränkungen betreffen nicht zuletzt auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen, denen der Zugang zu barrierefreien Technologien durch blockierte staatliche Regelungen erschwert wird.
Die Motivation hinter dem Vorstoß ist unklar – Experten bezweifeln, dass die Regelung eine bewusste Zerstörung des Föderalismus sein soll. Vielmehr scheint es sich um eine übermäßig weit gefasste und schlecht konzipierte Klausel zu handeln, die in der Praxis zu einem nahezu vollständigen Aussetzen staatlicher Aufsicht führen wird. Die Kombination aus weitreichender Definition, problematischen Ausnahmeregelungen und der langen Laufzeit der Ausnahme von zehn Jahren macht es beinahe unumgänglich, dass die Maßnahme nur schwer zu begrenzen oder anzupassen ist. Der politische Diskurs um die Regulierung von künstlicher Intelligenz und digitalen Systemen hat in den letzten Jahren zugenommen. Zweifelsohne besteht ein Bedarf an klaren bundesstaatlichen Regeln, um einen einheitlichen Rahmen zu schaffen und Innovation nicht zu ersticken.
Doch dieser Versuch darf nicht auf Kosten der grundständigen Rechtsverantwortlichkeit und der Schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger geschehen. Es braucht eine ausgewogene Lösung, die sowohl technologische Entwicklung fördert als auch demokratische Kontrolle, Verbraucherschutz und Rechtsstaatlichkeit wahrt. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass durch die Einführung der Moratoriumsklausel amerikanische Bundesstaaten für ganze Dekaden ihre Fähigkeit zur Regulierung von Technologiestandards und Schutzrechten verlieren. Dies könnte auch internationale Rückwirkungen haben, wenn Standards für Datenschutz, fairen Wettbewerb oder Verbraucherschutz in den USA ins Wanken geraten. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie Gerichte und Gesetzgeber mit den Folgen dieser weitreichenden Gesetzgebung umgehen.
Die Debatte macht jedoch deutlich, dass technologische Innovation und rechtliche Verantwortung nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Nur durch ein harmonisches Miteinander dieser beiden Aspekte kann eine zukunftsfähige und gerechte digitale Gesellschaft entstehen, in der sowohl Fortschritt als auch die Rechte der Menschen geschützt sind.