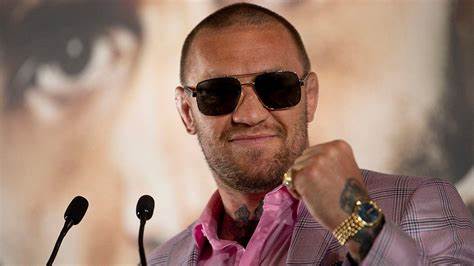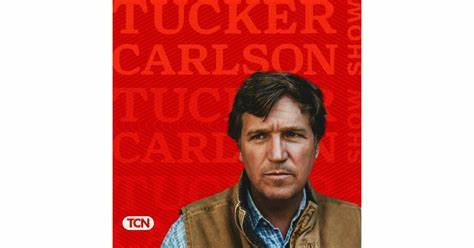Die politische Landschaft Irlands erlebt gegenwärtig eine bemerkenswerte Zersplitterung innerhalb des rechten Spektrums. Während die rechte und vor allem die extrem rechte Szene im Land in den vergangenen Jahren gewachsen ist, sind diese Gruppen mit erheblichen internen Konflikten, Machtkämpfen und ideologischen Differenzen konfrontiert. Im Zentrum vieler Debatten steht dabei die Frage, wie die far-right Bewegung einen politischen Durchbruch erzielen kann – und sie steht vor entscheidenden Weichenstellungen, die über ihre Zukunftsfähigkeit entscheiden könnten. Eine Schlüsselrolle in diesen Entwicklungen nimmt der ehemalige Mixed-Martial-Arts-Star und jetzige Anti-Einwanderungs-Aktivist Conor McGregor ein, dessen umstrittenes Auftreten selbst innerhalb der rechten Szene heftige Diskussionen entfacht hat. Der Einfluss von Conor McGregor auf die nationale rechte Bewegung lässt sich kaum überschätzen.
Durch seine prominente mediale Präsenz und seine Verbindung zu den USA, insbesondere seiner Unterstützung durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, hat McGregor eine starke Symbolkraft erlangt. Er kündigte sogar an, bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in Irland mit einer stark restriktiven Einwanderungspolitik anzutreten. Diese Ankündigung erzeugte zunächst den Eindruck, die verschiedenen separat agierenden rechten Gruppierungen könnten vielleicht in einer gemeinsamen Bewegung zusammenfinden. Doch hinter dieser vorgeschobenen Einigkeit offenbaren sich tiefgehende Spannungen, welche die gesamte Far-Right-Landschaft destabilisieren. Ein zentrales Spannungsfeld liegt in der Frage, welche politische Strategie verfolgt werden soll.
Eine Fraktion plädiert dafür, die extremistischen Positionen bewusst zu dämpfen, um breitere Wählerschichten anzusprechen, also den Weg der politischen Normalisierung zu suchen. Eine andere, radikalere Fraktion fühlt sich hingegen von der immer offener zur Schau gestellten weißen Nationalismus-Bewegung in anderen Ländern inspiriert und möchte diese Linie weiter vorantreiben. Diese Polarisation führt zu anhaltenden Streitigkeiten und spaltet zahlreiche Parteien und Gruppierungen bis ins Mark. Der National Alliance Versuch, eine Koalition aus mehreren rechten Parteien zu formen, scheiterte bitter in den letzten Wahlen. Die Allianz, bestehend aus Gruppen wie Ireland First, der National Party und den Irish People, konnte keinen einzigen Sitz gewinnen.
Dies brachte die Glaubwürdigkeit der rechten Bewegung auf lokaler wie nationaler Ebene in erhebliche Bedrängnis. Nur kurz darauf löste sich die Allianz aufgrund von „unerwarteten ideologischen und politischen Differenzen“ auf. Vorwürfe über mangelhafte Disziplin und fehlende strategische Ausrichtung überschatteten das Bündnis und führten zu öffentlichem Zwist. Parallel zu diesen Entwicklungen traten interne Konflikte in Einzelparteien zutage. So brachte insbesondere der Austritt des südlichen Dubliner Kreisrats Glen Moore aus der Irish Freedom Party die Zerstrittenheit der Bewegung ans Licht.
Moore bezeichnete die parteiinterne Führung als gescheitert und führte Unstimmigkeiten über Zielsetzungen und Führungsstil als Grund an. Die Reaktion der Parteiführung, vertreten durch Hermann Kelly, war ebenfalls scharf – gegenseitige Vorwürfe über Pflichtversäumnisse und Mitgliedsbeiträge wurden öffentlich gemacht. Die Irish Freedom Party steht dabei exemplarisch für einen Zwiespalt: Die Führungsspitze bemüht sich um eine gemäßigte, inklusive Ausrichtung und distanziert sich von extremistischen Mitgliedern, was jedoch auf Widerstand innerhalb der basisorientierten, radikalen Mitglieder stößt. Zu diesen Spannungen trägt auch die belastete persönliche Reputation von Conor McGregor bei. Der viel diskutierte Fall einer Verurteilung in der Zivilgerichtsbarkeit, bei dem er wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen wurde, sorgt für erheblichen Imageschaden.
Während manche Hardliner McGregor als Hoffnungsträger für die Rechte feiern, betrachten ihn andere als politisches Hindernis, dessen toxische Wirkung potenzielle Unterstützer abschreckt. Seine Aussicht auf eine ernsthafte Kandidatur für die Präsidentschaft gilt insgesamt als äußerst gering, was die Bewegung zusätzlich vor Fragen nach der strategischen Ausrichtung stellt. Die Gründung neuer Gruppierungen wie Ireland First, die sich als Alternative zu etablierten rechten Parteien positioniert, verdeutlicht die Instabilität der Szene. Diese Partei zog mit dem ehemaligen Gerichtsregistrar Anthony Casey auch ein prominentes Gesicht an Land und übernimmt den Part, Aktivisten aufzunehmen, die von anderen Organisationen enttäuscht sind. Doch auch innerhalb von Ireland First kam es zu internen Umbrüchen.
Der frühere Parteivorsitzende Derek Blighe trat überraschend zurück und warf der Organisation Versagen bei den Wahlen und Probleme in der Führung vor. Ein solcher Führungswechsel unterstreicht das fragile Machtgefüge und die wechselhaften Loyalitäten in der Bewegung. Statt einer Einheit herrscht ein permanenter Fluss von Übertritten, Austritten, Machtkämpfen und Rivalitäten. Neue Führungsgremien sollen oftmals die alten ablösen, gleichzeitig bilden sich militante Untergruppen mit eigenständigen Organisationseinheiten wie etwa bei Justin Barrett, dem ehemaligen National Party-Chef, der aufgrund umstrittener Statements über Hitler und Nationalsozialismus enormen innerparteilichen Widerstand auf sich zog. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, ihn abzulösen, gründete Barrett eigene Gruppierungen, die sich mit noch radikaleren Methoden positionieren.
Solche Entwicklungen erschweren eine nachhaltige Etablierung einer seriösen rechten Kraft in Irland. Experten für extremistische Bewegungen wie Ciaran O’Connor vom Institute for Strategic Dialogue erkennen ein typisches Muster: Die Zersplitterung und Rivalität sind auch selbstverstärkend. Führungspersönlichkeiten konkurrieren um Macht und Einfluss, oft stärker als um die eigentlichen programmatischen Ziele. Auch unterschiedliche persönliche Führungsstile, von autoritär bis inklusiv, verschärfen die Konflikte. Die Folge ist, dass sich keine rechte Gruppierung als offizieller parlamentarischer Vertreter etablieren konnte und die extrem rechte Szene somit weiter marginalisiert bleibt.
Diese interne Schwäche hat politische und gesellschaftliche Konsequenzen. Die Unfähigkeit der far-right Akteure, sich geschlossen zu präsentieren und ernsthafte Wahlerfolge zu erzielen, verhindert eine nachhaltige Einflussnahme auf die politische Agenda in Irland. Sie nährt zugleich die Unzufriedenheit und Radikalisierung vieler Anhänger, die sich von der parlamentarischen Politik abwenden und daher eher zu direkter Straßenmobilisierung oder radikaleren Aktionen tendieren. Dieses Spannungsfeld könnte für die Zukunft der politischen Stabilität im Land besonders relevant sein. Zumindest lassen sich einige Tendenzen ableiten: Der starke mediale Druck, die negativen gesellschaftlichen Reaktionen auf Extremismus sowie juristische Fälle wie die gegen McGregor, setzen die Bewegung unter erhöhten Rechtfertigungsdruck.
Zugleich wird die Suche nach einem charismatischen, dennoch konsensfähigen Führer zur zentralen Herausforderung. Sollten keine neuen Ansätze oder strategischen Kompromisse gefunden werden, drohen weitere Zersplitterungen mit negativen Folgen für die politische Wirksamkeit. Irlands far-right Bewegung steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Kombination aus persönlichen Skandalen, ideologischen Zerwürfnissen und der Unfähigkeit, ein breiteres politisches Publikum anzusprechen, lässt erkennen, dass die Bewegung trotz ihrer medienwirksamen Auftritte und emotionalen Mobilisierung noch weit davon entfernt ist, eine ernsthafte politische Kraft zu sein. Die nächsten Monate, besonders im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, werden zeigen, ob es der Rechten gelingt, sich zu konsolidieren oder ob sie endgültig in immer kleinere und rivalisierende Fraktionen zerfallen wird.
In jedem Fall bleibt klar, dass Irlands politische Landschaft vielschichtiger und weiter von rechts bestimmt sein wird – allerdings in einer Form, die von Konflikten und innerer Zersplitterung geprägt ist.