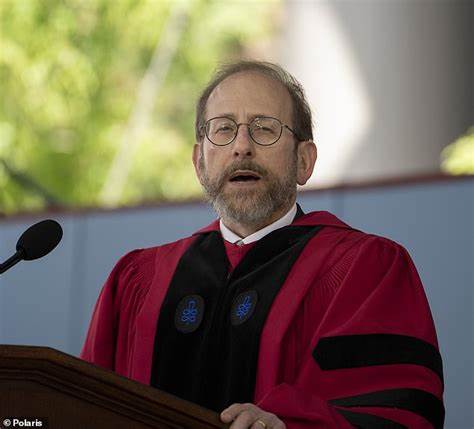Die Programmiersprache V zieht seit ihrer Ankündigung durch Alexander Medvednikov im Jahr 2020 viel Aufmerksamkeit auf sich. Sie sorgte gleichermaßen für Begeisterung wie für kritische Stimmen in der Entwickler-Community. V wurde mit ambitionierten Versprechen vorgestellt: eine Sprache, die einfache Syntax, moderne Sicherheitsmerkmale und gleichzeitig eine hohe Leistung mit minimalem Speicherverbrauch bietet. Doch mehrere Jahre nach ihrer Vorstellung bleibt die Frage bestehen, ob V diesen ambitionierten Ansprüchen tatsächlich gerecht wird. Der erste Eindruck von V ist vielversprechend.
Das Starten der Entwicklungsumgebung ist unkompliziert, es gibt eine REPL (Read-Evaluate-Print Loop), die schnelle Tests direkt im Terminal ermöglicht – ein Feature, das vor allem Entwickler von dynamischeren Sprachen begrüßen. Das einfache "Hello, World!"-Programm zeigt, dass V leicht verständlich und skriptähnlich wirkt, was eine niedrige Einstiegshürde verspricht. Eine Stärke von V liegt in der klaren und vergleichsweise eleganten Syntax. Im Vergleich mit anderen Systemsprachen wie Zig oder Odin wirkt V durchdachter und aufgeräumter. Viele Entwickler beschreiben V als frisch und minimalistisch, was besonders für alteingesessene C-Programmierer angenehm sein kann.
Die Lesbarkeit ist offensichtlich ein wichtiger Fokus der Entwickler von V. Technisch sieht V eine Reihe moderner Features vor, die in der heutigen Softwareentwicklung gefordert sind. Variablen sind standardmäßig unveränderlich, womit Fehler aufgrund unbeabsichtigter Zustandsänderungen reduziert werden sollen. Sicherheitsfunktionen wie Bereichsprüfungen bei Arrays, resultierende und optionale Typen sowie die vollständige Eliminierung von Nullzeigern sollen speicherbezogene Programmierfehler vermeiden helfen. Exemplare dieser Prinzipien gibt es auch in anderen zeitgenössischen Sprachen, doch V versucht sie zu einem einheitlichen und schlanken Gesamtpaket zu verbinden.
Zur Unterstützung der Nebenläufigkeit setzt V auf Go-ähnliche Channels und Kommunikationsmechanismen. Das Speicher- und Ressourcenmanagement ist als "autofree" ohne klassischen Garbage Collector konzipiert, was theoretisch für effizienten, niedriglatenz-orientierten Code sorgen könnte. Allerdings zeigt der Status quo, dass diese Autofree-Implementierung bislang eher ein Versprechen als eine ausgereifte Funktion ist. Tatsächlich kommt in der Praxis bisher ein klassischer Garbage Collector zum Einsatz, was die Performance- und Kontrollversprechen teilweise relativiert. V bietet eine eigene Paketverwaltung namens VPM, die vergleichbar mit bekannten Paketmanagern gestaltet ist und das Installieren von Bibliotheken vereinfacht.
Allerdings ist die Qualität und Quantität der verfügbaren Pakete noch begrenzt. Viele der Standardbibliotheken und Erweiterungen sind auf generierte Bindings zu bestehenden C-Bibliotheken aufgebaut, die zwar Funktionalität bieten, jedoch auch die Abhängigkeiten und Komplexität eines Projektes erhöhen können. Das umfangreiche Verwenden von C-Bibliotheken sorgt zudem für eine gewisse Intransparenz und potenzielle Stabilitätsrisiken. Ein Blick auf die Codebeispiele verdeutlicht den Zwiespalt. Die Bindings etwa der Grafiklibrarie Raylib wirken technisch funktional, sind aber uneleganter umgesetzt als in Sprachen wie Zig oder Odin.
Die automatische Typkonvertierung oder die Verwendung von integerbasierten Konstanten wirken hier eher mechanisch, was auf eine noch nicht ausgereifte Integration mit nativen V-Features hindeutet. Darüber hinaus scheint V in der Praxis häufig auf globalen Variablen zu setzen, was im Widerspruch zu seinen ursprünglichen Designprinzipien steht. Während globale Variablen offiziell als Problemfall behandelt werden und explizit aktiviert sein müssen, finden sie sich in mehreren Beispielprogrammen wieder, insbesondere wenn es um Interoperabilität mit C-Code geht. Auch hier zeigt sich, dass die klare Vision einer sauberen Architekturbasis zumindest teilweise bröckelt. Die viel beschworenen Sicherheitsfeatures und die „null-pointer-free“-Philosophie klingen zunächst zukunftsweisend.
Doch die Realität zeigt, dass die Sprache sich noch am Anfang ihrer Entwicklung befindet. Die Semantik wirkt teils unvollständig und unstetig; wichtige Funktionen wie die Speicherverwaltung sind noch nicht voll ausgereift. Für Entwickler, die präzises Ressourcenmanagement auf niedrigster Ebene erwarten, ist V damit (zumindest bisher) keine optimale Wahl. Im Vergleich mit anderen modernen Systemsprachen wie Rust, Zig oder Odin ist V derzeit eher ein Experiment mit viel Potenzial, aber auch mehreren Baustellen. Während Rust mit seiner Ownership-Philosophie und seinem ausgereiften Tooling als sicher und performant gilt, konzentrieren sich Zig und Odin auf minimalen Overhead und Kontrolle.
V behauptet, irgendwo zwischen diesen Ansätzen zu stehen, was zu einem eher lockeren Memory-Management führt, das allerdings noch nicht vollständig konkurrenzfähig wirkt. Die Entwicklungsgeschichte und das Management rund um V wirken ambitioniert, aber auch chaotisch. Von anfänglichen Veröffentlichungsversprechen auf Version 1.0 bis zum Stand von 2025 hat sich die Versionsnummer nur schleppend weiterentwickelt, und viele gesetzte Deadlines wurden verpasst. Ein häufig wiederholter Kritikpunkt ist das „Fake it till you make it“-Prinzip, was den Eindruck erweckt, dass viele Features mehr als Versprechen denn als Realität existieren.
Die Community-Resonanz spiegelt diese Ambivalenz wider. Es gibt treue Nutzer und aufrichtige Anhänger, die die Syntax und den Ansatz von V schätzen. Andererseits sind Zweifel an der Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit der Entwicklung allgegenwärtig. Kritische Stimmen führen die hohen Erwartungen ins Feld, die das Projekt schwer einlösen kann, verbunden mit der Tatsache, dass die Abhängigkeit von vielen externen C-Bibliotheken den Aufbau eines robusten und unabhängigen Ökosystems erschwert. Trotz dieser Einschränkungen positioniert sich V derzeit nicht als direkter Ersatz für C in Systemprogrammen, sondern eher als eine schlankere Alternative zu großen Sprachen wie Rust oder C++.
Seine Syntax bleibt der oft positiv hervorgehobene Pluspunkt, und erweckt den Eindruck eines aufgeräumten, modernen Werkzeugs, das auf Entwicklerfreundlichkeit ausgelegt ist. Der Ausblick in die Zukunft bleibt spannend. Wird es Medvednikov und dem Kernteam gelingen, die existierenden Schwächen zu überwinden? Schafft V den Sprung von einem experimentellen Projekt mit vielen Versprechungen zu einer stabilen, produktiven Sprache für den professionellen Einsatz? Die momentane Bewertung durch Indizes wie TIOBE, wo V im Mai 2025 immerhin auf Platz 43 rangiert, zeigt eine gewisse Aufmerksamkeit, allerdings fehlen auf anderen Plattformen wie Stack Overflow positive Signale. Für Interessierte lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf V, gerade im Kontext des Lernens neuer Sprachkonzepte. Es stellt eine frische Perspektive dar und bringt wichtige Ideen in die Diskussion moderner Systemsprache ein.
Für den produktiven Einsatz in ernsthaften Projekten sind Alternativen wie Odin, Zig oder Rust gegenwärtig noch zuverlässiger und ausgereifter. Zusammenfassend ist V eine faszinierende Entwicklung innerhalb der Programmiersprachenlandschaft, die viel hermacht, aber bislang nur bedingt hält, was sie verspricht. Die elegante Syntax und die moderne Ausrichtung sprechen für die Sprache, doch die jahrelange Entwicklungsverzögerung, die unvollständige Feature-Implementierung und die Abhängigkeit von externen C-Bibliotheken setzen klare Grenzen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob V sich beweisen und nachhaltig etablieren kann oder ob die hohen Erwartungen unerfüllt bleiben.



![The Unlikely Rise of the Indian Space Program [video]](/images/4E12EEC7-37AF-4A4A-945D-3C020C90AE81)