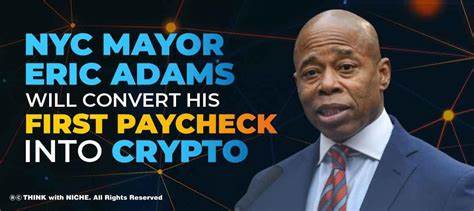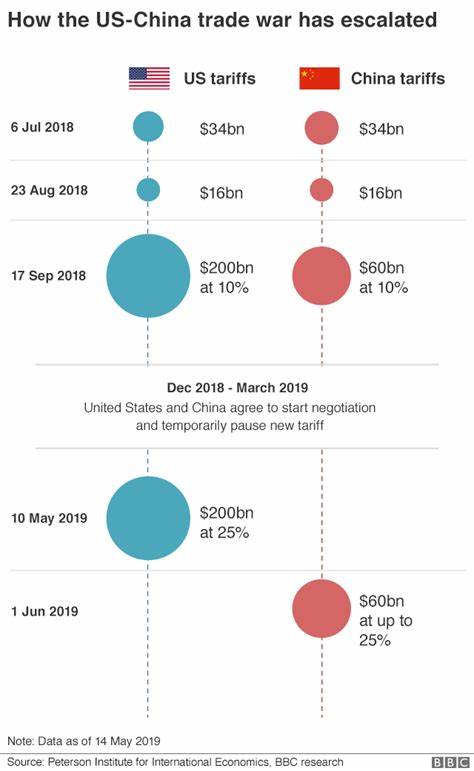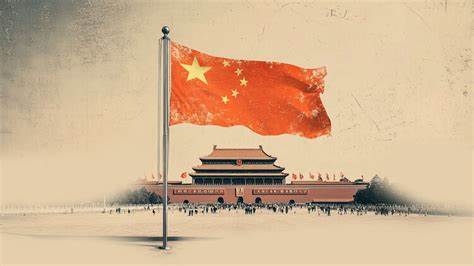In den letzten Jahren sind an zahlreichen amerikanischen Universitäten sogenannte Civic Centers oder Civics Centers entstanden, besonders an staatlichen Flaggschiff-Campussen in Bundesstaaten mit überwiegend konservativer Politik. Beispiele hierfür sind das Hamilton Center for Classical and Civic Education an der University of Florida, das School of Civic Life and Leadership in North Carolina, das School of Civic Leadership an der University of Texas at Austin, das Chase Center an der Ohio State University sowie das Institute of American Civics an der University of Tennessee. Ziel dieser Einrichtungen ist es, angeblich mehr „Meinungsvielfalt“ auf die teilweise als zu progressiv empfundenen Campus zu bringen und die klassische staatsbürgerliche Bildung sowie Führungskompetenzen wieder zu etablieren. Doch eine Vielzahl von Indizien und Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass diese neuen Bildungszentren heute schon viele Probleme aufweisen, die ihr Scheitern in naher Zukunft wahrscheinlich machen. Ein zentraler Ausgangspunkt beim Verständnis dieser Entwicklung ist die politische Motivation hinter der Schaffung der Civic Centers.
Öffentlich wird häufig betont, dass die bisherigen universitär geprägten Curricula eine vermeintliche Einseitigkeit aufweisen, die man mit einer institutionell gestützten „Wiederherstellung der klassischen Staatsbürgerkunde“ ausgleichen wolle. Dabei handelt es sich aber häufig um stark politisch gefärbte Definitionen, die sich an einem konservativen oder klassischen Kanon orientieren – meist mit Betonung auf der Geschichte der amerikanischen Gründerväter, westlichen Philosophien und klassischen politischen Texten. Der kritische Diskurs, der sich an manchen Universitäten etabliert hat, wird hier als „woke“ oder ideologisch motiviert abgewertet. Gleichzeitig werden in einigen Bundesstaaten wie North Carolina, Texas, Georgia und auch bereits seit längerem in South Carolina verpflichtende staatsbürgerliche Kurse für alle Studierenden eingeführt. Das wird von den Befürwortern als essenziell angesehen, um das staatsbürgerliche Verständnis in der breiten Bevölkerung wieder zu stärken.
Doch diese Maßnahme stößt auf Kritik, nicht zuletzt weil die Pflichtkurse häufig lediglich bestehende Geschichts- oder Regierungskurse in leicht modifizierter Form umfassen, was wenig inhaltliche Innovation oder neuen Erkenntnisgewinn verspricht. Eine der problematischsten Seiten an dieser Entwicklung ist das Fehlen einer einheitlichen wissenschaftlichen Grundlage oder eines klaren Kanons. Selbst die ältesten der neuen Civics Centers, wie Arizona State Universitys School of Civic and Economic Thought and Leadership, verfügen nicht über ein kohärentes Curriculum, sondern stützen sich lediglich vage auf sogenannte „klassische Werke“. Ohne einen klar definierten akademischen Rahmen fehlt die Möglichkeit, unter Dozenten und Studierenden eine gemeinsame Basis für tiefergehendes, kritisches Lernen und solidarisches Engagement aufzubauen. Dies schwächt die Position der Civic Centers gegenüber universitären Verwaltungsebenen, die stetigen Eingriffen und Anpassungen unterliegen und letztlich eher institutionellen Interessen als pädagogischer Verständigung folgen.
Besonders eindrucksvoll wird die Problematik, wenn man die Entstehung der Civic Centers mit der von Black Studies Ende der 1960er Jahre vergleicht. Im Gegensatz zu den Civic Centers entstanden die Black Studies Programme aus dem Druck einer sozialen Bewegung heraus und verfolgten ein klares Ziel: die curriculare Vielfalt zu erweitern, akademische Räume für bislang marginalisierte Gruppen zu schaffen und die Forschung zu einem vernachlässigten Themenfeld voranzubringen. Diese Disziplin konnte auf unmittelbares Interesse bei Studierenden zählen, zeigte so rasch eine hohe Nachfrage und breite institutionelle Akzeptanz. Die Civic Centers können von einem vergleichbaren Gründungsimpuls oder studentischem Engagement nicht profitieren – ihre Entstehung wirkt oftmals eher top-down gesteuert durch staatliche Legislative und Hochschulverwaltungen, was die Erfolgschancen reduziert. Ein wesentlicher Hintergrund für die massenhafte Einführung solcher staatsbürgerlicher Angebote liegt zudem in einer ganz pragmatischen Problematik, die auf den ersten Blick wenig mit Bildungsfragen zu tun hat: der Umgang mit dem NCAA Transfer Portal für studentische Athleten.
Seit einige NCAA-Regelungen gelockert wurden und Athletinnen und Athleten nun wesentlich einfacher zwischen Universitäten wechseln können und dabei unmittelbar spielberechtigt sind, ist der Druck auf Hochschulen enorm gestiegen, flexible und nahtlos an anderen Hochschulen anrechenbare Kurse anzubieten. Diese Kurse dienen als „übertragbare Bausteine“, um die sogenannten Fortschrittskriterien im Studium zu erfüllen und so keinen Verlust von Spielberechtigung und Team-Performance zu riskieren. Die wirtschaftlichen Dimensionen sind dabei beachtlich: Spitzenuniversitäten mit Sportprogrammen generieren durch absolviert sportliche Erfolge Millionenumsätze, seien es Teilnahme- und Gewinnprämien bei March Madness Basketballturnieren oder Footballevents. Der Verlust eines Spitzenathleten, der wegen fehlender anrechenbarer Studienleistungen den Transfer nicht schafft, kann daher erhebliche finanzielle Konsequenzen mit sich bringen. Deshalb werden Kurse bevorzugt, die überall anerkannt sind, leicht zu absolvieren und wenig riskant hinsichtlich ihrer Anerkennung.
Im Idealfall wollen Universitäten mit den Civic Centers also General Education Kurse in Civics etablieren, die einerseits den gesetzlichen Vorgaben zur staatsbürgerlichen Bildung entsprechen und andererseits nahtlos zwischen Universitäten anerkannt und übertragen werden können. Ein zusätzlicher Vorteil für die Hochschulverwaltung ist, dass solche Kurse außerhalb der regulären akademischen Strukturen etabliert werden können und nicht mehr den gewohnten Fakultätsvertretungen oder internen Qualitätskontrollen unterliegen, die ein kritisches Hinterfragen oder Infragestellen der Inhalte erschweren. In der Praxis bedeutet dies oftmals die Beschäftigung von Ph.D.-Kandidaten oder angestellten Lehrbeauftragten zu Adjunct-Tarifen, denen vorgegebene Lehrpläne vorgegeben werden – eine Art „Credit Factory“.
Diese Entwicklung hat Folgen für die Qualität und Tiefe der staatsbürgerlichen Bildung. Anstatt Studierenden Raum für fundierte, kritische Auseinandersetzung mit politischen Inhalten zu geben, verkommen die Kurse häufig zu Pflichtveranstaltungen, die vor allem der Formalität und der bürokratischen Abwicklung des Studienprozesses dienen. Das Lernumfeld wird dadurch entwertet, was nicht zuletzt Studierende und Lehrende gleichermaßen demotiviert. Die Anpassung an logistische und administrative Erfordernisse steht selten im Einklang mit inhaltlicher Bildungsetztigkeit. Zudem wurden bereits Stimmen laut, die kritisieren, dass diese massenhaften Civics-Kurse eine Art „Abschwächung“ oder Verwässerung staatsbürgerlicher Bildung bedeuten.
In einigen Bundesstaaten werden solche Kurse etwa mit Online-Tests kombiniert, die wenig pädagogische Tiefe besitzen. Die Gefahr politischer Vereinnahmung steigt dadurch ebenso, wie das Risiko, dass akademische Standards zu Gunsten administrativer Vorgaben abgebaut werden. In Fakultäten und bei wissenschaftlichen Organisationen gibt es daher teils Kritik an der schnellen und womöglich aus politischem Kalkül vollzogenen Einführung solcher Curricula, ohne ausreichend Zeit für Evaluation und qualitätsvolle Integration. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Civic Centers vor komplexen Herausforderungen stehen, die ihre Erfolgschancen deutlich mindern. Ohne eine klare wissenschaftliche Verortung, ohne studentische Nachfrage und mit dem Ziel, administrativen Erfordernissen gerecht zu werden, drohen sie im Sog bürokratischer Zwänge zu reinen Erfüllungsmaschinen verkommen, die wenig zur tatsächlichen staatsbürgerlichen Bildung beitragen.
Die langfristige Wirkung auf die universitäre Kultur und das politische Verständnis der Studierenden bleibt somit fraglich. Das Phänomen der Civic Centers und die damit verbundenen Anforderungen an GenEd-Angebote sind zudem bisher ein amerikanischer Sonderfall, der international kaum Parallelen findet. Weder europäische Bologna-Prozesse noch andere OECD-Länder verpflichten Studierende flächendeckend zum Besuch eines staatsbürgerlichen Kurses mit Schwerpunkt auf Gründungsdokumenten oder Verfassungstexten. Diese amerikanische Spezifik ist verbunden mit politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die eine solche Entwicklung möglich machen, aber zugleich den Bildungsauftrag zumindest teilweise zu verwässern drohen. Die Vorstellung, dass Civic Centers die Lösung für eine vermeintliche „krise der staatsbürgerlichen Bildung“ an Universitäten seien, greift daher zu kurz.
Vielmehr handelt es sich um ein bürokratisch geprägtes Instrument, das sowohl auf politische Agenda-Setting als auch auf die Anforderungen der College-Athletik-Industrie reagiert. Die resultierenden Entwicklungen, darunter ein Rückgang der akademischen Qualität, das Fehlen einer kohärenten didaktischen Linie und der Verlust autonomen akademischen Gestaltens, sprechen gegen eine nachhaltige Wirkung. Für die Zukunft bleibt spannend, wie sich die Civics Centers weiterentwickeln. Werden sie es schaffen, tiefergehende Diskurse zu fördern und Studierende wirklich für die Komplexität staatsbürgerlicher Fragen zu begeistern? Oder wird die „Credit Factory“ Dominanz behalten, in der einzig die Erfüllung von Verwaltungskriterien zählt? Offen bleibt auch, welche Rolle innovative Technologien wie künstliche Intelligenz bei der Vermittlung genereller Bildungsinhalte spielen werden, gerade wenn Hochschulen zunehmend digitalisierte, auf Outcomes basierende Kurse langsam annehmen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die neuen Civic Centers gegenwärtig mehr den Symptomen eines Systems begegnen, als die dringend benötigten Antworten für eine zeitgemäße staatsbürgerliche Bildung zu liefern.
Damit steht zu erwarten, dass sie den ursprünglichen Anspruch, gerade auch jenseits politischer Vorgaben, nicht erfüllen werden. Die Hoffnung mancher Initiatoren, mit wenig Aufwand aber großem Effekt ein Systemproblem lösen zu können, dürfte sich in der Realität hingegen als trügerisch herausstellen.