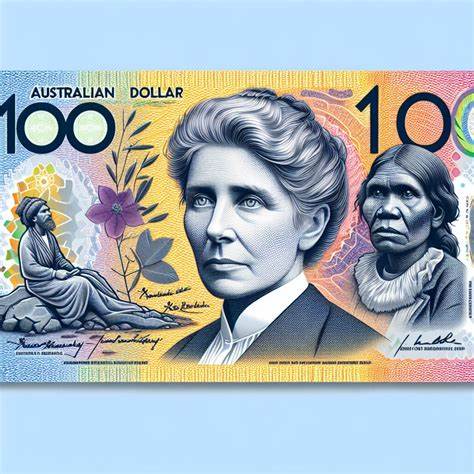Homebrew, das beliebte Paketverwaltungssystem für macOS, hat mit der Version 4.5.0 einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Die neueste Version, veröffentlicht am 29. April 2025 und maßgeblich von Mike McQuaid vorangetrieben, bringt zahlreiche Verbesserungen und wichtige Änderungen mit sich, die sowohl macOS- als auch Linux-Anwender ansprechen.
Homebrew hat sich über die Jahre als unverzichtbares Tool für Entwickler etabliert, die auf einfache Weise Software installieren, verwalten und aktualisieren möchten. Die Version 4.5.0 besticht vor allem durch großzügige Erweiterungen in den Bereichen Paketverwaltung, Linux-Unterstützung und Performanceoptimierung sowie durch eine klar strukturierte Tiersystem-Unterstützung. In diesem Beitrag erfahren Sie alles Wissenswerte zur neuesten Homebrew-Version, deren Vorteile und worauf Nutzer künftig besonders achten sollten.
Ein Schwerpunkt von Homebrew 4.5.0 liegt auf der neuen, verbesserten Handhabung von brew bundle und brew services. Diese Befehle, die früher über externe Taps verfügbar waren, sind jetzt direkt in das System integriert. Dadurch wurde nicht nur die Nutzererfahrung hinsichtlich Stabilität und Geschwindigkeit deutlich verbessert, sondern auch die Dokumentation deutlich ausgebaut.
Interessant ist zudem, dass brew bundle nun keine Filterung der Nutzerumgebung mehr durchführt, was mehr Flexibilität bei der Verwendung von Umgebungsvariablen bietet. Die Möglichkeit, mehrere Formulae gleichzeitig mit brew services zu verwalten, erleichtert den Workflow deutlich. Darüber hinaus können Brewfiles jetzt eine version_file-Durchlaufbeschreibung verwenden, mit der etwa .ruby-version Dateien automatisch anhand installierter Versionen aktualisiert werden. Diese Neuerungen erleichtern insbesondere Entwicklern das Verwalten komplexer Projektabhängigkeiten und Umgebungen.
Eine bedeutende Erweiterung bezieht sich auf die Linux-Unterstützung von Homebrew, speziell im Bereich der sogenannten „Casks“. Casks sind Pakete, die oft Software mit grafischer Benutzeroberfläche oder spezialisierte Anwendungen umfassen. Bisher waren sie hauptsächlich auf macOS beschränkt. Mit der Version 4.5.
0 führt Homebrew nun eine vorläufige Linux-Unterstützung für Casks ein, wobei hauptsächlich Schriftarten und Linux-Binärdateien unterstützt werden. Dies hat zur Folge, dass das frühere Homebrew Linux Fonts Cask Tap mittlerweile als veraltet gilt. Die Möglichkeit, Casks plattformübergreifend per brew bump-cask-pr zu aktualisieren, stellt einen großen Schritt zur Harmonisierung der Paketpflege dar. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass manche Casks aufgrund der engen Verbindung zum macOS-Ökosystem nicht für Linux verfügbar sein werden, was die bestehende Softwarelandschaft respektiert. Die offizielle Einführung eines Supports-Tiersystems in Homebrew 4.
5.0 bringt Klarheit und Transparenz für Nutzer und Entwickler. Das System besteht aus drei dokumentierten Support-Stufen sowie einer Kategorie für nicht unterstützte Software. Tier 1, ehemals als „supported“ bezeichnet, garantiert die Bereitstellung von fertigen installierbaren Paketen, sogenannten Bottles, sowie eine kontinuierliche Integration (CI). Im Rahmen des erweiterten brew doctor Befehls werden Nutzer jetzt auf das entsprechende Support-Tier hingewiesen.
Zusätzlich beinhaltet brew doctor neue Prüfungen für den OpenCore Legacy Patcher und macht transparent, dass dieser als Tier 2 oder 3 Support gilt. Das neue Tiersystem hilft, die Stabilität, Verfügbarkeit und den Supportgrad verschiedener Pakete besser einzuordnen und vermittelt Sicherheit bei der Benutzung. Ein weiterer großer Schritt in der Version 4.5.0 betrifft die Unterstützung für ARM64 Linux, die immer wichtiger wird, da ARM-basierte Systeme zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Homebrew stellt jetzt eine portable Ruby-Version speziell für ARM64 Linux zur Verfügung, was den Weg ebnet, diesen Plattformtyp langfristig im Tier 1 Support aufzunehmen. Dabei wird konsequent von ARM64 Linux gesprochen und nicht von AArch64 Linux, um eine konsistente Terminologie mit macOS zu gewährleisten. Zudem veröffentlicht das Projekt erste Docker-Images für ARM64, was insbesondere die Containerisierung vereinfacht. Diese Innovationen zeigen, dass Homebrew den Trend zu alternativen Hardwareplattformen aktiv mitgestaltet und seine Nutzerbasis erweitern möchte. Die interne Ruby-Umgebung wurde ebenfalls aktualisiert.
Homebrew verwendet jetzt Portable Ruby 3.4.3 und setzt einen Mindeststandard von Ruby 3.4 voraus. Dies bedeutet, dass auf dem System mindestens Ruby Version 3.
4 installiert sein muss, um Homebrew auszuführen. Darüber hinaus wurde das Booten durch Bootsnap standardmäßig aktiviert, was die Startzeiten von Homebrew signifikant reduziert. Bootsnap optimiert die Geschwindigkeit durch intelligentes Caching, sodass wiederholte Aufrufe von brew Befehlen deutlich flüssiger ablaufen. Das verbessert die tägliche Nutzung und steigert die Effizienz insbesondere bei größeren Projekten. Mit der Version 4.
5.0 wurden außerdem einige ältere Komponenten und Funktionen zugunsten von Verbesserung und Sicherheit eingestellt. So wurde unter anderem das Ubuntu 18 Docker-Image entfernt, da es nicht mehr zeitgemäß und zu wartungsintensiv war. Die konsequente Entfernung veralteter Elemente trägt dazu bei, die Codebasis schlanker und sicherer zu halten. Neben den Kernänderungen gibt es eine Vielzahl kleinerer, aber für Anwender sehr nützlicher Optimierungen.
So ermöglicht der neue Befehl brew install --ask einen interaktiven Installationsdialog, der Pakete, Abhängigkeiten und deren Größen vor der Installation anzeigt. Dies schafft Transparenz und Kontrolle, was gerade bei komplexen Installationen hilfreich ist. Mit --skip-link kann auf die automatische Verknüpfung verzichtet werden, was individuelle Setup-Szenarien unterstützt. Zudem hält brew update-if-needed das System flott, indem es nur dann Updates durchführt, wenn diese wirklich notwendig sind. Das erleichtert das Management und spart Zeit.
Weitere Funktionen erlauben es, Pakete als Abhängigkeiten zu installieren ohne sie explizit „auf Anforderung“ zu registrieren. Auch die Nutzung von Homebrew als Root innerhalb von Podman-Containern ist erstmals möglich, was Container-Szenarien noch flexibler macht. Der Standard-Temporärordner unter Linux wurde auf /var/tmp festgelegt, sofern dieser beschreibbar ist, was Kompatibilitätsprobleme minimiert. Verbesserungen bei der Integration mit GitHub Actions und Unterstützung für die neueste GCC-Version 15 runden das Bild ab. Entwickler profitieren auch von praktischen Erweiterungen wie der automatischen Synchronisierung von pyenv-Versionen und der Unterstützung verschiedener Code-Editor-Varianten in Befehlen wie brew edit und brew bundle edit.
Die Community und das Projektteam haben zudem die Basis für eine modernere Paketpflege geschaffen. Es ist nun möglich, Pakete mithilfe von PowerShell- oder Clap-Completion-Dateien auszustatten. Externe Patches können jenen Pfad erwähnen, den die Variable HOMEBREW_PREFIX referenziert, was Patching einfacher und flexibler macht. Beim Anlegen oder Aktualisieren von Pull Requests etwa mit brew bump-* wurde das Verhalten dahingehend angepasst, dass doppelte PRs bei nicht offiziellen Taps nur noch gewarnt statt blockiert werden. Dies erleichtert den Umgang mit extern gepflegten Paketen immens.
Darüber hinaus legt Homebrew 4.5 großen Wert auf verbesserte Wartung und Sicherheit. Die Migration weg von den traditionellen pkg-config Dateien hin zu pkgconf wird konsequent fortgeführt und von Audit-Warnungen begleitet. Paketverifikationswerkzeuge sind nun präsenter und erzeugen mehr Transparenz über die Herkunft und Zuständigkeit installierter Software. Auch die Integration lokaler Betriebssystemfunktionen, etwa das Ersetzen von veralteten Lock-Methoden durch die neue macOS lockf Implementierung, zeigt Homebrews Engagement für moderne Betriebssystemanpassungen.
Die Unterstützung für macOS-Systeme wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst. So wird die Unterstützung für macOS 13 im CI-Prozess reduziert und die Tests werden zugunsten neuerer Versionen eingestellt, da ältere Systeme zunehmend an Bedeutung verlieren und der Aufwand für die Pflege zu hoch wird. Ein bedeutender technischer Schritt ist die Umstellung auf SSH-basiertes Git Commit Signing, die mehr Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in die Entwicklungskette bringt. Neben den technischen Neuerungen wagt Homebrew auch einen offenen Dialog mit seiner Community. Die Beziehung zu alternativen Manager-Projekten wie Workbrew wird näher erläutert und transparent kommuniziert.
Außerdem sind Möglichkeiten zu Spenden weiterhin präsent und es wird auf alternative Wege zur Unterstützung des Projekts hingewiesen. Das alles unterstreicht die enge Verbindung zwischen Entwicklern, Anwendern und dem Team hinter Homebrew. Abschließend zeigt die Version 4.5.0 eindrucksvoll, dass Homebrew kontinuierlich an der Spitze der Paketverwaltung für macOS und Linux bleibt.
Die Verbesserung der Linux-Unterstützung, insbesondere für ARM64, die Erweiterung und Integration bedeutender Befehle wie brew bundle und brew services sowie die Modernisierung der Entwicklungsumgebung machen Homebrew zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Entwickler und Technikbegeisterte. Die neuen Support-Tiers schaffen Klarheit, während Performanceoptimierungen und Sicherheitsmaßnahmen für eine zuverlässige Bedienung sorgen. Wer auf effiziente Paketverwaltung setzt, sollte die Möglichkeiten der neuesten Version von Homebrew unbedingt kennen und für sich nutzen. Homebrew 4.5.
0 ist der nächste logische Schritt in die Zukunft der plattformübergreifenden Softwareverwaltung und zeigt klar, dass die Open-Source-Community auch weiterhin innovative Lösungen für vielseitige Nutzerbedürfnisse liefert.