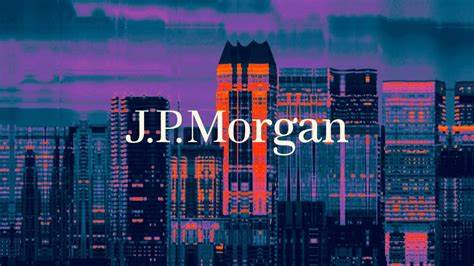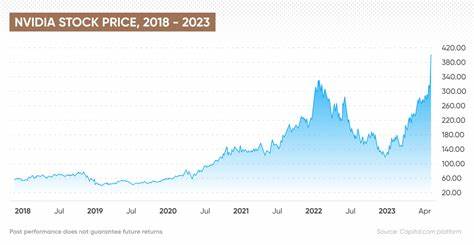Die Österreichische Schule der Wirtschaftswissenschaften, gegründet von Ludwig von Mises und weiterentwickelt von Murray Rothbard, wird oft für ihre originellen Ansätze und kritischen Perspektiven auf die Mainstream-Ökonomie geschätzt. Doch trotz ihres Einflusses und einzigartigen Denkansätze lässt sich diskutieren, warum ich mich selbst nicht als Anhänger dieser Schule bezeichnen würde. Die Arbeit von Bryan Caplan, einem Wirtschaftsprofessor, der selbst die österreichische Theorie intensiv studierte, liefert wertvolle Einsichten in die Schwächen und Limitationen dieser Denkrichtung. Seine kritische Auseinandersetzung mit der Österreichischen Schule zeigt, dass einige ihrer zentralen Behauptungen entweder übertrieben dargestellt oder schlichtweg falsch sind. Gleichzeitig hebt er die bedeutenden Fortschritte hervor, die die neoklassische Ökonomie erzielt hat und die von den Österreichischen Ökonomen oft nicht ausreichend anerkannt werden.
Die philosophischen und methodologischen Differenzen beginnen bereits bei den theoretischen Fundamenten. Die Österreichische Schule richtet sich bewusst gegen die neoklassischen Grundpfeiler wie Nutzenfunktionen, Indifferenzanalyse und das Kaldor-Hicks-Wohlfahrtskriterium. Stattdessen greifen Mises und Rothbard auf Konzepte wie die „Wertskalen“ zurück, die Präferenzen lediglich ordinal erfassen, also in Rangordnungen darstellen, ohne auf quantitative oder kardinale Messgrößen zurückzugreifen. Dies führt zu grundlegenden Missverständnissen: Die neoklassische Theorie verwendet zwar Nutzenfunktionen, diese basieren jedoch vorwiegend auf ordinalen Präferenzen und nicht auf kardinalen, messbaren Größen. Eine falsche Interpretation dieser mathematischen Werkzeuge lässt es so erscheinen, als ob die Neoklassiker eine starke quantitative und messbare Interpretation von Nutzen hätten – was jedoch nicht der Fall ist.
Dadurch entstehen vermeintliche Gegensätze, die eher auf Missverständnissen beruhen als auf tatsächlichen theoretischen Konflikten. Ein weiterer zentraler Unterschied liegt im Umgang mit dem Konzept der Indifferenz. Die neoklassische Ökonomie hat Indifferenzkurven entwickelt, um Momente darzustellen, in denen Konsumenten zwischen Optionen ohne Präferenzdifferenz stehen. Für die Österreichische Schule stellt das ein Problem dar, da sie strikt an der Annahme festhält, dass Präferenzen ausschließlich durch bewusste Handlungen offenbar werden können. Indifferenz wird folglich als unlogisch betrachtet, da sie keine Handlung motivieren könne.
Doch diese Haltung ignoriert einen wichtigen Aspekt menschlicher Entscheidungsprozesse: Menschen können durchaus innere Zustände der Gleichgültigkeit oder Unentschiedenheit besitzen, die nicht sofort durch Handlungen auf den Markt übertragen werden, aber dennoch existieren. Die österreichische Ablehnung dieser Vorstellung wirkt in einer Welt, in der Introspektion und mentale Zustände neben Handlungen eine bedeutende Rolle spielen, übertrieben. Die Frage der mathematischen Formalisierung ist ebenfalls ein zentrales Thema. Mises und Rothbard lehnen die weit verbreitete Nutzung von Mathematik in der Ökonomie ab, vor allem wegen der Annahme der Kontinuität der Präferenzen, die notwendig ist, damit man Funktionen differenzieren oder Gleichgewichtspunkte bestimmen kann. Dieser Standpunkt führt jedoch zu Problemen: Ohne Kontinuität ist die Standardannahme, dass Angebot und Nachfrage sich in einem sauberen Schnittpunkt treffen, kaum haltbar.
Die explizite Strenge der österreichischen Position macht es schwer, selbst einfache Konzepte wie preiskausal determinierten Markträumen oder Stabilitätsanalysen mathematisch zu verankern. Die Konsequenz ist, dass die Ökonomik der Österreichischen Schule zwar tiefgründige qualitative Einsichten bietet, aber den Zugang zu den mächtigen analytischen Werkzeugen moderner Ökonometrie und mathematischer Modellierung verwehrt. Die Kritik erstreckt sich auch auf angewandte Theoriegebiete, etwa die Wirtschaftskalkulation und das „Unmöglichkeitsargument“ des Sozialismus. Mises argumentierte, eine sozialistische Planwirtschaft könne nicht funktionieren, weil sie keine ökonomische Kalkulation ermöglichen würde. Dieses Argument wurde oft als entscheidend angesehen, ist aber in seiner Aussagekraft limitiert.
Die empirische Wirklichkeit zeigt, dass viele Probleme im Sozialismus vielmehr aus faktischen Anreizproblemen, Eigentumsrechteverletzungen und politischen Fehlentscheidungen resultieren – nicht allein aus einem Mangel an ökonomischer Kalkulation. Zudem gibt es grundlegende logische Widersprüche: Mises behauptet, Wirtschaftstheorie könne nur qualitative Aussagen machen, doch sein Kalkulationsproblem wird mit einer sehr starken quantitativen Behauptung vorgetragen – nämlich, dass die fehlende wirtschaftliche Kalkulation zwangsläufig zum Scheitern einer sozialistischen Gesellschaft führt. Dies stellt einen inneren Widerspruch dar und zeigt eine Überinterpretation theoretischer Resultate. Auch in der Monopoly-Theorie zeigen sich Schwächen. Rothbard versucht, das Konzept marktbeherrschender Monopole auszuschließen („Marktmonopolien gibt es nicht ohne staatliche Eingriffe“), doch die moderne neoklassische Theorie hat gezeigt, dass Marktmacht auch ohne Staatsintervention existieren kann und dass dabei Ineffizienzen entstehen.
Solche Ineffizienzen, wie der sogenannte Wohlfahrtsverlust durch zu hohe Preise, sind ein reales Problem, das nicht ignoriert werden kann. Allerdings hat Rothbard richtig darauf hingewiesen, dass der Staat häufig künstliche Monopole schafft und damit echte Marktmechanismen verzerrt. Damit bleibt sein Beitrag weitgehend als Warnung vor staatlicher Fehlregulierung in der Ökonomie wichtig. Eine besonders umstrittene Komponente der Österreichischen Schule ist die sogenannte Österreichische Konjunkturtheorie (Austrian Business Cycle Theory, ABC). Grundsätzlich erkennen auch mainstream-Ökonomen an, dass Arbeitslosigkeit oft durch starr nach oben gerichtete Reallöhne entsteht und dass Geldpolitik kurzfristig Zinsen beeinflussen kann.
Doch die Österreichische Theorie vermutet, dass durch künstlich niedrige Zinsen Investitionen in sogenannte „rundeabout“ (längerfristige und komplexe) Projekte stimuliert werden, die letztlich Fehlinvestitionen (Malinvestments) darstellen. Diese Überinvestitionen müssten nach einer anschließenden Zinskorrektur zur Wirtschaftskrise führen. Die Problematik ist jedoch, dass damit Unternehmern unterstellt wird, sie würden systematisch und kollektiv irrational handeln, indem sie eine vorübergehend niedrige Zinsrate für dauerhaft halten – was wenig plausibel erscheint. Markterfahrene Unternehmer und Finanzspezialisten verfügen über Instrumente, um zukünftige Zinsentwicklungen einzuschätzen, wodurch ein solches verallgemeinertes Ausmaß an Fehleinschätzungen schwer erklärbar ist. Darüber hinaus zeigt eine Analyse, dass die ABC-Theorie weder den vollständigen Rückgang der Produktion während Rezessionen erklären kann, noch konsistent interpretiert, warum Beschäftigung in bestimmten Sektoren stärker fällt als in anderen.
Andere Modelle der Kapital- und Konsumgüternachfrage bieten einfachere und empirisch stützbare Erklärungen. Ebenso eignet sich die Theorie nicht exklusiv, um Stagflation – also gleichzeitige hohe Inflation und Arbeitslosigkeit – zu erklären, da andere gut begründete Theorien für solche Phänomene existieren. Grundsätzlich kritisiert Caplan, dass die Österreichische Schule sich methodologisch zu sehr auf A-priori-Deduktion und idealtypische Theorie beschränkt und empirische Belege oder quantitative Methoden ablehnt oder ignoriert. Die Fortschritte der letzten Jahrzehnte, etwa mit der Anwendung von mathematischen Modellen, Spieltheorie, Rational-Expectations-Ansätzen und sorgfältiger empirischer Analyse, wurden von der Neoklassik getragen und haben große Teile der Wirtschaftswissenschaften revolutioniert. Die Abneigung der Österreichischen Ökonomen gegenüber diesen Werkzeugen hat sie in der akademischen Welt weitgehend isoliert und ihre Forschungsergebnisse schwer zugänglich gemacht.
Gleichzeitig ist nicht zu leugnen, dass einzelne Ökonomen der Österreichischen Schule durchaus wertvolle Ansätze liefern, etwa in der Theorie des freien Bankwesens oder bei der kritischen Analyse staatlichen Handels. Ihre Beiträge sollten jedoch nicht zuletzt als Ergänzungen zur Mainstream-Ökonomie betrachtet werden, die auf Bewährtem aufbauen statt eine ganze Disziplin umzukrempeln. Die Orientierung an realen wirtschaftlichen Daten und moderner Methodik ist unerlässlich, um wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen, ohne die wichtigste Funktion der Wirtschaftstheorie – die Erklärung und Vorhersage wirtschaftlicher Abläufe – preiszugeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Österreichische Schule trotz ihrer originellen Ansätze und kritischen Perspektiven einige grundlegende Schwächen und Unstimmigkeiten aufweist. Ihre Ablehnung mathematischer und empirischer Methoden schränkt ihre analytische Kraft ein.
Zudem beruhen langlebige Thesen auf Missverständnissen moderner Theorien und auf übertriebenen oder nicht haltbaren Behauptungen. Der Weg zur Integration bewährter insights in eine moderne, empirisch gestützte Wirtschaftswissenschaft bietet mehr Potenzial als die Suche nach einer radikalen Alternative. Wie Milton Friedman treffend bemerkte, gibt es keine „österreichische Ökonomie“, sondern nur gute und schlechte Ökonomie – und die beste Ökonomie ist nicht notwendigerweise österreichisch.