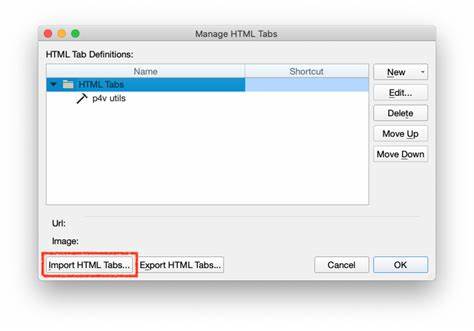Lemuren gelten in der Tierwelt als ein außergewöhnliches Beispiel für matriarchale Gesellschaftsstrukturen. Anders als bei vielen anderen Tierarten übernehmen hier oft die Weibchen die Führung – und zwar häufig durch aggressives Verhalten, um ihre Dominanz zu behaupten. Dieses dominante Verhalten zeigt sich besonders bei einigen Lemurenarten wie den blauäugigen schwarzen Lemuren, deren Weibchen durch Schläge, Bisse und Vertreibungen gegenüber den Männchen ihre Prioritäten bei Nahrung und Ruheplätzen durchsetzen. Die Wissenschaft hat diese Art von Verhalten lange Zeit als typisch betrachtet, doch neue Forschungen am Duke Lemur Center haben interessante Entwicklungen beleuchtet, die das Bild von Lemuren-Gruppen deutlich erweitern. Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass evolutionäre Veränderungen im Gehirn bestimmter Lemurenarten zu einem harmonischeren Miteinander zwischen Weibchen und Männchen führen können.
Dabei spielt ein spezieller Neurotransmitter eine entscheidende Rolle: Oxytocin, oft als „Liebeshormon“ bezeichnet, das soziale Bindungen und Vertrauen fördert. Forscher der Duke University untersuchten sieben nahe verwandte Lemurenarten aus der Gattung Eulemur. Dabei wurde deutlich, dass nicht alle Lemurenarten weibliche Dominanz durch Aggression ausüben. Einige haben sich innerhalb der letzten Million Jahre evolutiv dahin entwickelt, dass sie ein gleichberechtigteres Zusammenleben zwischen den Geschlechtern pflegen. Der sogenannte „kollarierte“ Lemur ist ein Beispiel dafür.
Weibchen und Männchen teilen sich hier sozial und physisch den Raum auf Augenhöhe, ohne die deutliche Aggressivität, die bei anderen Arten wie den blauäugigen schwarzen Lemuren beobachtet wird. Diese friedfertige Dynamik spiegelt eine deutliche Abkehr von den Tyrannenrollen einiger Weibchen wider. Doch was ist die treibende Kraft hinter diesem Wandel? Die Antwort liegt im Gehirn: Mithilfe der Technik der Autoradiographie kartierten die Wissenschaftler die Verteilung der Bindungsstellen für Oxytocin im Gehirn der verschiedenen Lemurenarten. Offenbar besitzen die egalitären Arten mehr Oxytocin-Rezeptoren, insbesondere im Bereich der Amygdala. Diese Hirnregion ist bekannt für ihre Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen wie Angst, Wut und Aggression.
Mehr Oxytocin-Rezeptoren in der Amygdala deuteten darauf hin, dass das Hormon dort intensiver wirken kann, was das Verhalten weniger aggressiv und sozial verträglicher macht. Herausragend war, dass dieser Unterschied sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen gleich ausgeprägt ist. Das legt nahe, dass der Übergang zu mehr Gleichberechtigung nicht durch eine verstärkte Aggressivität der Männchen gegenüber den Weibchen zustande kam, sondern dadurch, dass die Tiere im Allgemeinen friedvoller wurden. Der Wandel im Hormon-Rezeptor-System führte also zu weniger Konflikten und einem ausgewogeneren sozialen Gefüge. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse reicht weit über die Welt der Lemuren hinaus.
Oxytocin ist nicht nur bei Primaten zentral für soziale Bindungen, sondern auch beim Menschen mit Aspekten wie Vertrauen, Empathie und sozialem Verhalten verbunden. Störungen im Oxytocin-System werden unter anderem mit aggressivem Verhalten, Störungen der Persönlichkeitsentwicklung und Autismus in Verbindung gebracht. Die neuen Erkenntnisse aus der Lemurenforschung könnten daher helfen, die biologischen Grundlagen solcher Verhaltensweisen besser zu verstehen und langfristig therapeutische Ansätze verbessern. Zudem geben sie wertvolle Einblicke in die evolutionäre Entwicklung von sozialen Strukturen bei Tieren. Die Forscher planen, die Untersuchung von Oxytocin-Rezeptoren mit weiteren sozialen Verhaltensweisen bei Lemuren zu verknüpfen.
Interessant ist unter anderem, ob Eigenschaften wie die Neigung zur Geselligkeit oder ein eher zurückgezogenes Leben ebenso mit hormonellen Veränderungen im Gehirn korrelieren. Die Monogamie, das Sozialverhalten in Gruppen oder das Phänomen der männlichen Fürsorge bei manchen Lemurenarten könnten weitere spannende Forschungsfelder sein. Auch außerhalb der Lemuren eröffnet das Verständnis von hormoneller Steuerung soziale Dynamiken, die weitreichende Einflüsse auf Art und Weise des Zusammenlebens und der evolutionären Anpassung haben. Die Studien bestätigen einmal mehr, wie eng genetische und hormonelle Faktoren mit Verhalten und sozialen Systemen verknüpft sind. Insbesondere bei jungen Forschungsgemeinschaften, die sich mit Verhaltensbiologie und Neurowissenschaften beschäftigen, bieten Lemuren einen einzigartigen Einblick, wie komplexe Verhaltensänderungen über vergleichsweise kurze evolutionäre Zeiträume entstehen können.
Für die wissenschaftliche Gemeinschaft und darüber hinaus fördern diese Ergebnisse das Verständnis, dass selbst scheinbar aggressive oder dominante Verhaltensweisen bei Tieren biologisch fundiert und veränderbar sind. Der Wandel von als „böse“ oder „tyrannisch“ empfundenen weiblichen Lemuren hin zu ausgeglicheneren Gruppenmitgliedern zeigt die Kraft evolutionärer Prozesse und hormoneller Regulation. Insgesamt zeigt die Forschung, wie wichtig interdisziplinäre Ansätze sind, in denen Verhaltensforschung, Neurowissenschaft und Evolution zusammengeführt werden. Die Einblicke aus dem Duke Lemur Center sind exemplarisch für den großen Wert einer gezielten Erforschung von bedrohten Arten und ihres Sozialverhaltens. Zugleich führen sie uns vor Augen, wie relevante Grundlagenforschung zur Verbesserung des Verständnisses sozialer Verhaltensweisen bei Menschen beitragen kann.
Letztlich gewähren Lemuren dank ihrer Biologie und gesellschaftlichen Variationen einen faszinierenden Blick auf den Zusammenhang von Gehirn, Hormonen und Verhalten – ein Thema, das uns Menschen ebenso betrifft wie diese einzigartigen Primaten.