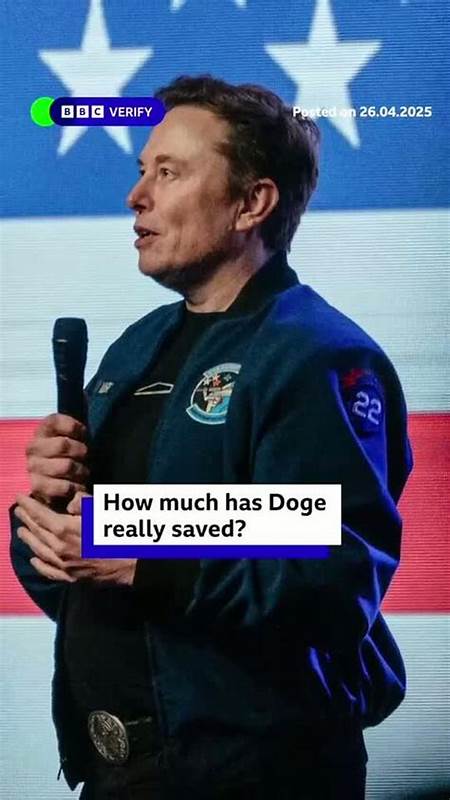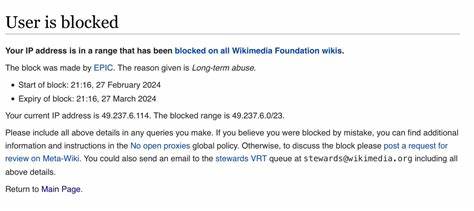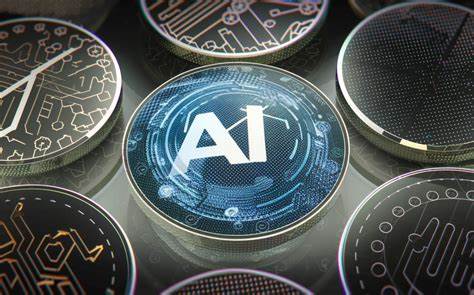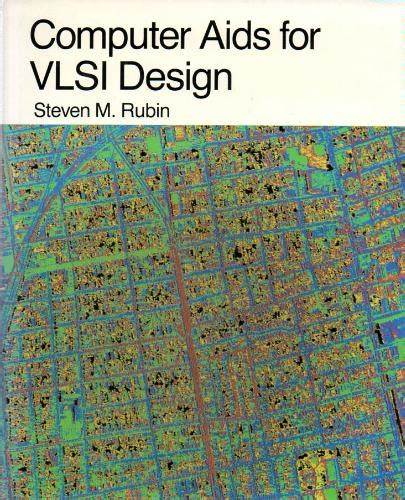Seit dem Amtsantritt von Donald Trump hat Elon Musk mit der Gründung des Department of Government Efficiency, kurz Doge, ambitionierte Ziele zur Reduzierung der US-Regierungsausgaben gesetzt. Das Ziel: Einsparungen in Billionenhöhe, durchgeführt durch das Kürzen von Verträgen, Zuschüssen und Leasings sowie durch die Bekämpfung von Betrug und die Verringerung der staatlichen Belegschaft. Doch wie viel Geld hat Doge tatsächlich eingespart und wie solide sind die veröffentlichen Zahlen? Die Thematik ist komplex und verlangt eine kritische Auseinandersetzung mit den Behauptungen und der vorliegenden Evidenz. Beim Verfolgen der von Doge gemeldeten Einsparungen fällt zunächst auf, dass das Institut selbst angeblich wöchentlich Einsparungen von mehr als zehn Milliarden US-Dollar generiert hat. Trump äußerte gegenüber BBC, dass die Gesamteinsparungen bei knapp 200 Milliarden Dollar und steigend lägen.
Die Öffentlichkeit und zahlreiche Experten zeigen sich jedoch skeptisch hinsichtlich der tatsächlichen Höhe und der Nachvollziehbarkeit dieser Zahlen. Die Zielsetzungen waren anfangs sogar noch höher gesteckt: Elon Musk versprach eine Kürzung des Bundeshaushaltes um mindestens zwei Billionen US-Dollar, reduzierte später dieses Ziel um die Hälfte und peilte für das Finanzjahr 2026 Einsparungen im Umfang von 150 Milliarden Dollar durch den Abbau von Betrug und Verschwendung an. Im Vergleich dazu betrug das US-Bundeshaushaltsvolumen im letzten finanziellen Jahr etwa 6,75 Billionen Dollar, was verdeutlicht, dass Doges Einsparziele einen signifikanten Anteil an den gesamten Ausgaben einnehmen würden. Auf der offiziellen Doge-Website lässt sich ein laufendes Einsparungs-Totalsummen-Tracking finden, das zuletzt einen Wert von 160 Milliarden US-Dollar auswies. Dabei offenbart sich ein relevantes Problem: Nur rund 40 Prozent dieser Summe wird durch detaillierte Einzelposten untermauert.
Diese Einzelposten wiederum weisen häufig eine schwache oder gar fehlende dokumentarische Grundlage auf. So ergab eine Analyse der von Doge veröffentlichten Einzelsummen, dass lediglich etwa die Hälfte der postenspezifischen Angaben mit belegenden Dokumenten verknüpft sind. Ein weiteres Problem stellen erkennbare buchhalterische Fehler dar. So wurde beispielsweise ein vermeintlicher Einsparbetrag von acht Milliarden Dollar beim Abbruch eines Immigrationsvertrags veröffentlicht, obwohl der tatsächliche Vertragswert lediglich acht Millionen Dollar ausmachte. Ein Vertreter von Doge betonte, dass insgesamt etwa 30 Prozent der Einsparbelege in einer verständlichen und transparenten Form auf der Website vorhanden seien, während der Rest aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich sei, was die unabhängige Prüfung erschwert.
Experten wie David Drabkin, der an der Entwicklung der US-amerikanischen Bundesvertragsdatenbank Federal Procurement Data System (FPDS) beteiligt war, empfehlen bei der Bewertung der Doge-Einsparungen große Vorsicht. Viele angegebene Beträge repräsentieren nicht den tatsächlich ausgezahlten Geldbetrag, sondern eine Obergrenze vertraglicher Verpflichtungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken können. Das bedeutet, dass ein Vertragswert von mehreren Milliarden Dollar einen hypothetischen Maximalwert darstellt und nicht etwa eine sofortige oder gar effektiv eingesparte Summe. Ein prominentes Beispiel für eine von Doge gemeldete große Einzelersparnis ist ein mit fast drei Milliarden Dollar bezifferter Stopp eines Vertrages für eine Einrichtung in Texas zur Unterbringung von bis zu 3000 unbegleiteten minderjährigen Migranten. Die Analyse zeigte, dass hier mehrheitlich mit den projektierten Gesamtkosten bis zum Abschluss des Vertrages im Jahr 2028 gerechnet wurde.
Da der Vertrag allerdings jährlich überprüft und neu beschlossen werden sollte, waren diese Gesamtkosten keineswegs garantiert. Quellen aus dem Umfeld des Vertrags beziffern den tatsächlichen Einsparbetrag auf etwa 153 Millionen Dollar. Dieser Wert setzte sich aus den eingesparten Fixkosten der Einrichtung zusammen, nachdem die Schließung angekündigt worden war, und ist weit von den von Doge veröffentlichten Zahlen entfernt. Der Verlauf des Migrantenzustroms hatte ebenfalls Einfluss auf die tatsächlichen Kosten, denn die maximale Kapazität der Einrichtung wurde nie erreicht. Allerdings bewegten sich die belegten Fallzahlen vor allem in den Monaten vor Schließung deutlich unterhalb der vertraglichen Maximalauslastung.
Weitere große Einsparpotenziale, die Doge ins Feld führt, stammen aus der Stornierung von IT-Verträgen mit Firmen wie Centennial Technologies oder A1FEDIMPACT. Bei diesen Aufträgen handelt es sich zum Teil um langfristige Verträge mit Höchstbeträgen, die im System zwar als Vertragswert geführt werden, jedoch nicht zwingend eine bereits erfolgte oder gar eingesparte Zahlung repräsentieren. Aussagen von Unternehmensvertretern und eine Bewertung von Branchenexperten legen nahe, dass diese Einsparungen nicht oder kaum realisiert wurden und teilweise bereits vor der Doge-Intervention durch die Vorgängeradministration storniert worden seien. Auch eine als Einsparung behauptete Streichung eines Grants an die globale Gesundheitsorganisation Gavi konnte nicht unabhängigen Nachprüfungen standhalten. Zwar sind dort Zahlungen von etwa 880 Millionen Dollar nachvollziehbar, jedoch gibt es keinen offiziellen Nachweis einer beendeten Förderung.
Ein Sprecher von Gavi bestätigte, dass sie keine Benachrichtigung über eine Vertragsbeendigung erhalten hätten. Die Unklarheiten und Widersprüche in der Veröffentlichung von Doge-Einsparungen werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, solche Einsparungen in der öffentlichen Verwaltung transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Verwendung maximaler Vertragswerte als Einsparbasis verzerrt die tatsächliche Leistung und kann den Eindruck massiver Kostensenkungen erzeugen, wo in Wahrheit nur Verträge nicht vollständig ausgeschöpft oder zum regulären Zeitpunkt verlängert wurden. Das Problem wird durch unvollständige, verzögerte oder unzugängliche Daten zusätzlich verschärft. Auch die mangelnde Kommunikation seitens Doge und die Ankündigung, Belege nicht vollständig aus rechtlichen Gründen veröffentlichen zu können, behindern eine unabhängige und kritische Prüfung der Behauptungen.
Im April 2025 kündigte Elon Musk an, sich zugunsten seiner anderen Unternehmungen wie Tesla aus operativen Aufgaben bei Doge zurückzuziehen, was die Zukunft der Initiative zusätzlich unsicher macht. In den USA und international wird derzeit intensiv darüber diskutiert, ob und wie solche Privatisierungsansätze im Kern staatlicher Verwaltungsaufgaben sinnvoll sind und welchen Beitrag sie realistisch leisten können. Trotz der zweifellos vorhandenen Möglichkeiten zur Eindämmung von Verschwendung im öffentlichen Sektor geraten Doges gemeldete Einsparungen aufgrund fehlender Belege und zu optimistischer Bewertungsmethoden in die Kritik. Es bleibt abzuwarten, ob die Behörde künftig transparenter agiert und ihre Einsparpotenziale klarer und überprüfbarer dokumentieren kann. Der Fall zeigt aber auch die Herrschaft von Zahlen in der Politik, wie beeindruckende Summen oft ungeprüft von Medien und Politikern aufgegriffen werden, ohne dass tiefergehende Prüfungen stattgefunden haben.
Für politische Entscheidungsträger, Bürger und Medien ist es daher zentral, solche Meldungen mit einem gesunden Maß an Skepsis zu betrachten und genaue Analysen zu fordern, um tatsächliche Fortschritte von bloßer Rhetorik zu unterscheiden. Insgesamt lässt sich resümieren, dass Elon Musks Doge zwar ambitionierte Ziele verfolgt und möglicherweise einige reale Einsparungen erzielt hat, die veröffentlichten Summen jedoch vielfach auf nicht verifizierbaren Berechnungen basieren. Eine genaue Bilanz der tatsächlichen Auswirkungen auf die US-Regierungsausgaben bleibt daher zum jetzigen Zeitpunkt schwierig und vor allem ohne unabhängige Kontrollmöglichkeiten unvollständig. Die Diskussion über die Effizienzsteigerung der öffentlichen Verwaltung und den sinnvollen Einsatz von Technologien sowie privatem Management wird damit um eine Facette reicher, die sorgfältig weiter beobachtet und evaluiert werden muss.