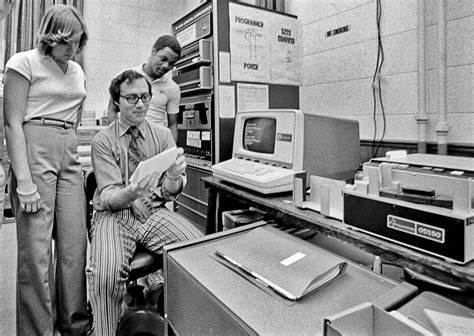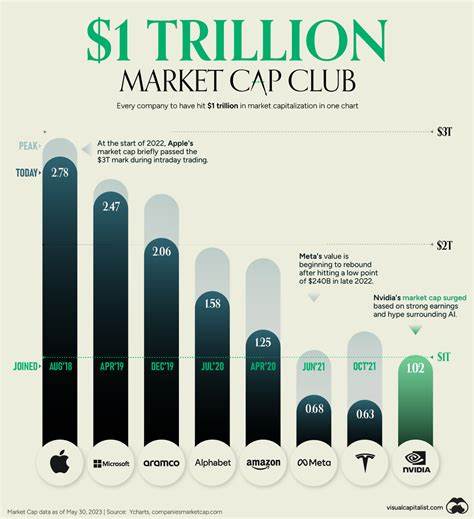In den dichten Wäldern Ugandas, genauer gesagt im Budongo-Wald, zeigen Schimpansen ein Verhalten, das bisher nur dem Menschen vorbehalten schien: Sie leisten Erste Hilfe füreinander und lassen sich in medizinischer Versorgung beobachten. Eine aktuelle Studie, die drei Jahrzehnte an Beobachtungen mit acht Monaten intensiver Feldforschung kombiniert, hebt hervor, dass diese Primaten weitaus komplexer im Umgang mit Verletzungen und Leiden sind, als bislang angenommen wurde. Die Fähigkeit zur Selbstversorgung mit Heilpflanzen und die Bereitschaft, anderen zu helfen, werfen ein neues Licht auf die Evolution der Gesundheitsfürsorge und das soziale Verhalten von Tieren. Forscher dokumentierten insgesamt 41 Fälle, in denen Schimpansen eigenständig Maßnahmen ergriffen, um Verletzungen oder Unannehmlichkeiten zu behandeln. Während die meisten dieser Fälle Selbstpflege und Hygiene betrafen, etwa das Reinigen des eigenen Körpers mit Blättern oder das Kauen von Pflanzen, die dann auf Wunden aufgetragen wurden, ist das Verhalten, anderen Schimpansen zu helfen, besonders bemerkenswert.
Obwohl nur in sieben Fällen beobachtet, bieten diese Situationen einen Einblick in das soziale und altruistische Potenzial der Tiere. In vier dieser Fälle wurde Hilfe auch ohne enge verwandtschaftliche Bindung gewährt. Ein eindrucksvolles Beispiel aus dem Jahr 2008 zeigt einen männlichen Schimpansen, der eine weibliche Artgenossin aus einer Nylonfalle befreite, die von Jägern aufgestellt worden war. Ein weiterer Vorfall aus dem Jahr 2012 dokumentierte, wie ein männlicher Schimpanse eine Wunde eines anderen männlichen Tieres aussaugte, um diese zu reinigen und zu pflegen. Solche Handlungen erfordern nicht nur Empathie, sondern auch ein Verständnis dafür, dass Leiden und Schmerzen von anderen erkannt werden können und Handlungen zur Linderung notwendig sind.
Diese Erkenntnisse werfen grundsätzliche Fragen über die Einzigartigkeit des menschlichen Altruismus und Empathievermögens auf. Wissenschaftler nehmen an, dass viele Verhaltensweisen, die wir traditionell als ausschließlich menschlich betrachteten, tief in unserer evolutionären Geschichte verwurzelt sind. Durch die enge Verwandtschaft zwischen Menschen und Schimpansen erhalten wir ein Fenster zur Vergangenheit, das uns verstehen lässt, wie frühe Formen von Fürsorge und Gesundheitsverhalten sich entwickelt haben könnten. Die Verwendung von medizinischen Pflanzen ist dabei von besonders großem Interesse. Schimpansen scheinen bestimmte Blätter und Rinden gezielt auszuwählen, um diese auf Wunden aufzutragen oder gegen Parasitenbefall einzusetzen.
Dieses Wissen könnte sowohl genetisch verankert als auch durch Lernen und Beobachtung erlangt worden sein. Beobachtungen zeigen, dass jüngere Schimpansen die Heilmethoden von älteren Artgenossen beobachten und sogar nachahmen, was auf eine Art „medizinische Kultur“ hindeutet. Die Art und Weise, wie Heilwissen innerhalb der Gruppen weitergegeben wird, ist ein spannendes Feld für weitere Forschungen. Doch trotz dieser altruistischen Verhaltensweisen ist das Helfen selektiv. Forscher fragen sich, warum nicht alle bedürftigen Schimpansen aufgefangen werden.
Einige Theorien gehen davon aus, dass in einem Lebensraum mit hohem Verletzungsrisiko, wie dem Budongo-Wald, die Tiere vermehrt zur gegenseitigen Hilfe neigen. Darüber hinaus scheint die Sozialstruktur, aber auch individuelle Beziehungen und vielleicht der Gesundheitszustand der Helfenden selbst eine Rolle zu spielen. Diese Dynamiken müssen noch genauer erforscht werden, um die Motive und Selektivität der Fürsorge unter Schimpansen zu verstehen. Dass Schimpansen nicht die einzigen Tiere sind, die sich selbst medizinisch versorgen, zeigt die vergleichende Forschung in anderen Spezies. Wildlebende Orang-Utans nutzen beispielsweise ebenfalls Heilpflanzen, um Wunden zu behandeln.
Elefanten und verschiedene Reptilien greifen zur Selbstmedikation auf natürliche Ressourcen zurück. Diese Beobachtungen sprechen für ein weit verbreitetes, evolutionär altes Phänomen, das sich in verschiedenen Tierarten unabhängig voneinander entwickelt hat. Sie unterstreichen die Bedeutung von Umweltbeobachtung und Anpassung im Überlebenskampf. Für die Forschung bieten diese Erkenntnisse vielfältige Impulse: Die Evolution der Medizin und der menschlichen Heilkunst war bislang vor allem ein Thema der Archäologie und Anthropologie. Nun aber deutet sich an, dass biologisch und sozial tief verwurzelte Verhaltensweisen die Grundlage für komplexe Formen der Gesundheitsfürsorge bilden.
Durch den Vergleich mit unseren nächsten Verwandten können Wissenschaftler neue Theorien über den Ursprung humaner Fürsorge, Altruismus und Empathie entwickeln. Die Entdeckung, dass Schimpansen zwischen Helfen und Nicht-Helfen wählen, regt zudem zu ethischen und philosophischen Debatten an. Was macht Fürsorge eigentlich aus? Ist sie an Bedingungen geknüpft oder eine universelle Pflicht Lebewesen gegenüber? Die Antwort darauf kann auch Rückschlüsse auf das menschliche Verhalten und soziale Strukturen erlauben. Die Erkenntnisse über die medizinischen Fähigkeiten der Schimpansen belegen zudem, welch enge Verbindung Evolution, Verhalten und Umwelt bilden. Natürliche Gefahren wie Fallen oder Verletzungen durch Rivalen animieren zu solidarischem Verhalten.
Gleichzeitig formen Beobachtung und Nachahmung die Kultur der Gruppe. Hier verschmelzen Instinkt und Lernen zu einem komplexen System der Gesundheitsfürsorge, das manchmal sogar jene Verhaltensweisen übertrifft, die wir traditionell dem Menschen zuschreiben. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, planen Wissenschaftler weitere Langzeitstudien, um nicht nur das Verhalten zu beschreiben, sondern auch die sozialen und ökologischen Bedingungen zu analysieren, die Fürsorgeverhalten begünstigen oder hemmen. Die Untersuchung des genetischen Hintergrunds, ebenso wie die Analyse individueller Persönlichkeiten innerhalb der Gruppen, sind weitere Ansatzpunkte. Letztlich öffnet die Beobachtung von Schimpansen als Erste-Hilfe-Leistern ein faszinierendes Fenster auf unsere eigene Entstehungsgeschichte.