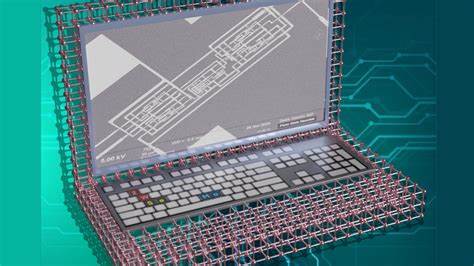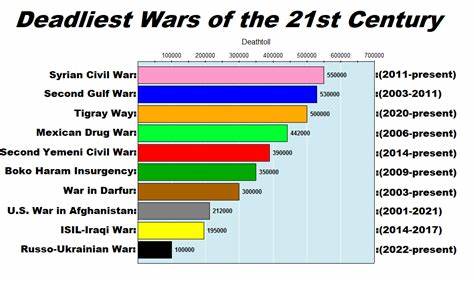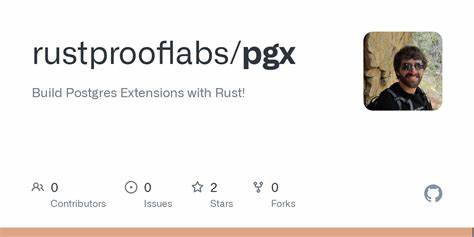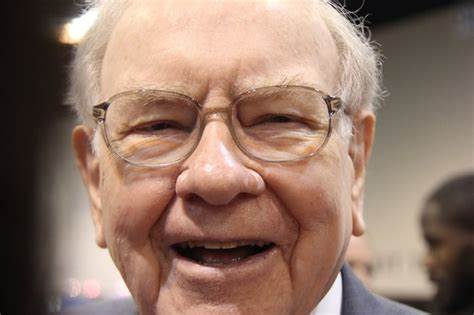Die Technologie der Computerentwicklung durchläuft eine grundlegende Wandlung, die das Potenzial hat, ganze Industrien zu verändern und die Art und Weise, wie wir elektronische Geräte nutzen, nachhaltig zu beeinflussen. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die jüngste Errungenschaft des Forschungsteams der Penn State Universität: die Entwicklung des weltweit ersten Computers, der gänzlich ohne Silizium hergestellt wurde und stattdessen auf zweidimensionalen (2D) Materialien basiert. Diese Innovation, die am 11. Juni 2025 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, markiert einen bedeutenden Schritt in der Halbleitertechnologie und könnte die Grenzen der Leistungsfähigkeit, Miniaturisierung und Energieeffizienz von Computern neu definieren. Silizium war über Jahrzehnte das unangefochtene Dominanzmaterial in der Elektronik.
Die Halbleiterindustrie, die das Herz moderner Geräte wie Smartphones, Computer, Elektrofahrzeuge und viele andere Technologien bildet, stützt sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts auf Silizium als Basis für Transistoren und integrierte Schaltkreise. Trotz jahrzehntelanger Miniaturisierung und immer höherer Leistungsfähigkeit zeigt Silizium inzwischen physikalische und technologische Grenzen. Bei extrem kleinen Bauteilen tritt ein Leistungsverlust ein, der sich negativ auf die Geschwindigkeit und Effizienz auswirkt. Das Forschungsteam der Penn State University hat diese Herausforderung angenommen und eine innovative Lösung vorgestellt: einen Computer, der nicht nur aus zwei verschiedenen 2D-Materialien besteht, sondern auch vollständig ohne Silizium auskommt.
Das Fundament dieses revolutionären 2D-Computers bildet die Verwendung von atomar dünnen Materialien, die nur wenige Atomlagen dick sind und dennoch herausragende elektronische Eigenschaften aufweisen. Im Gegensatz zu Silizium behalten diese 2D-Materialien auch in extrem dünner Bauweise ihre Leitfähigkeit und Stabilität bei, was für die Entwicklung ultraschneller und energiesparender Bauteile von größter Bedeutung ist. Das Team verwendete zwei unterschiedliche 2D-Halbleiter: Molybdändisulfid (MoS2) für n-Typ-Transistoren und Wolframdiselectenid (WSe2) für p-Typ-Transistoren. Diese Kombination ermöglichte die Herstellung von CMOS-Logikschaltungen, die in praktisch allen modernen elektronischen Geräten eingesetzt werden. Die Verwendung von CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ohne Silizium ist eine technische Meisterleistung, denn CMOS-Technologie benötigt sowohl n- als auch p-dotierte Transistoren, die gemeinsam arbeiten, um eine hohe Leistung bei niedrigem Stromverbrauch zu gewährleisten.
Während frühere Forschungsarbeiten kleinere Schaltkreise mit 2D-Materialien demonstrierten, blieb der Schritt zu komplexeren und funktionsfähigen Computern bislang aus. Der 2D-Computer von Penn State jedoch kann einfache logische Operationen ausführen, auch wenn die Frequenz mit ca. 25 Kilohertz derzeit noch weit unter der von Siliziumchips liegt. Dies stellt dennoch einen großen Fortschritt dar, da diese Gerätekategorie damit erstmals vollständig ohne Silizium funktionierte. Das Wachstum der verwendeten Materialien wurde mittels einer Technologie namens Metal-organische chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD) realisiert.
Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das es ermöglicht, großflächige, gleichmäßige Schichten von MoS2 und WSe2 auf einem Substrat herzustellen. Über 1000 Transistoren jedes Typs wurden vom Team fabriziert, wobei die präzise Steuerung der Schwellenwerte dieser Transistoren essenziell für deren zusammenwirkende Funktion war. Die Fähigkeit, diese Schwellenwerte fein einzustellen, war entscheidend für die Entwicklung eines voll funktionsfähigen CMOS-Schaltkreises, der für die Logikoperationen des Computers notwendig ist. Die Vision, Computer mit 2D-Materialien zu entwickeln, hat bedeutende Vorteile gegenüber herkömmlichen Siliziumchips. Zum einen ermöglichen die atomar dünnen Schichten eine bisher unerreichte Miniaturisierung, die zukünftig noch kompaktere und leichtere Geräte hervorbringen kann.
Zum anderen ist der Stromverbrauch dank der CMOS-Technologie in Kombination mit den einzigartigen Eigenschaften der 2D-Materialien erheblich geringer. Dies eröffnet neue Perspektiven für den Einsatz in tragbaren und energieeffizienten Anwendungen. Für die Leitenden Forscher, zu denen Professor Saptarshi Das zählt, stellt ihr Erfolg einen Meilenstein dar, der nicht nur die Leistungsfähigkeit von Computern neu definieren könnte, sondern auch das Ende der Ära von Silizium als dominierendes Halbleitermaterial einleiten kann. Der Forschungsstand an 2D-Materialien ist relativ jung und begann etwa um das Jahr 2010, weshalb die Entwicklung dieser Technologie noch am Anfang steht. Im Vergleich dazu wird Silizium seit ungefähr 80 Jahren intensiv erforscht und weiterentwickelt.
Die Fortschritte mit 2D-Materialien haben somit ein enormes Wachstumspotenzial, das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die gesamte Elektroniklandschaft verändern könnte. Neben dem wissenschaftlichen Durchbruch sind es vor allem die Forschungsinfrastrukturen der Penn State Universität, insbesondere das 2D Crystal Consortium Materials Innovation Platform (2DCC-MIP), die diese Innovation ermöglicht haben. Hier stehen hochmoderne Labore und Werkzeuge zur Verfügung, die speziell auf die Erforschung und Anwendung von 2D-Materialien ausgerichtet sind. Die Zusammenarbeit zahlreicher Experten aus verschiedenen Disziplinen unterstreicht die Komplexität und den interdisziplinären Charakter dieses zukunftsweisenden Projekts. Die USA fördern solche Technologien traditionell mit Mitteln von Institutionen wie der National Science Foundation, dem Army Research Office und dem Office of Naval Research.
Diese finanzielle Unterstützung hat es Forschern ermöglicht, die Grenzen der bekannten Halbleitertechnologien zu erweitern und die Grundlagen für eine neue Generation elektronischer Geräte zu legen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen deutlich, wie wichtig diese Förderungen für den technologischen Fortschritt sind. Die Auswirkungen dieser Innovation sind weitreichend. Die Aussicht auf Computer und elektronische Bauteile, die nicht nur kleiner und schneller, sondern auch deutlich energieeffizienter sind, öffnet die Tür für zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen. Angefangen bei der Hochleistungsrechnertechnologie über tragbare oder flexible Elektronik bis hin zu Sensoren und Geräten im Internet der Dinge – überall dort könnten 2D-basierte Transistoren und Computer zukünftig Silizium ablösen und somit neue Standards setzen.
Darüber hinaus bietet die atomare Dünnheit der 2D-Materialien Potenzial für neuartige, flexible und sogar transparent herstellbare Elektronik. Dies könnte zu einer Revolution bei Displays, Wearables und anderen Geräten führen, deren Formfaktor bisher durch die steifen Siliziumchips limitiert war. Kritisch bleibt jedoch die weitere Optimierung der Leistung und der Herstellungsprozesse. Der derzeitige 2D-Computer arbeitet zwar schon funktionsfähig, aber mit einer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit und einer einfachen Befehlssatzarchitektur. Die Forschung muss daher daran arbeiten, komplexere und schnellere 2D-Computersysteme zu entwickeln, die im praktischen Einsatz mit der Siliziumtechnologie konkurrieren können.
Dennoch stellen die erzielten Ergebnisse einen vielversprechenden Anfang dar. In der Summe zeichnet sich ein neues Kapitel in der Halbleitertechnologie ab, das mit dem weltweit ersten 2D-Computer ohne Silizium einen historischen Meilenstein erreicht hat. Die Kombination von Forschungsknow-how, neuartiger Materialwissenschaft und modernster Fertigungstechnik hat die Vision realisiert, Computerkomponenten atomar dünn und gleichzeitig funktional und energiesparend zu gestalten. Die Entwicklung von Penn State belegt, dass die Zukunft der Elektronik über Silizium hinausgeht und eröffnet faszinierende Perspektiven für Technologie, Wirtschaft und unseren Alltag.