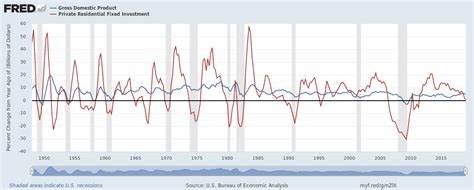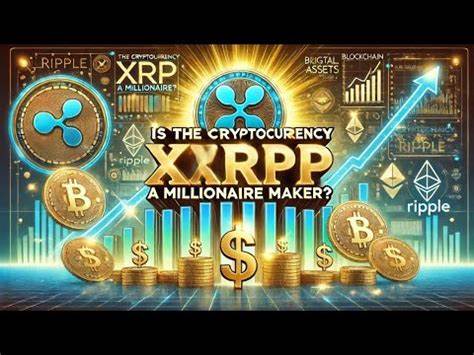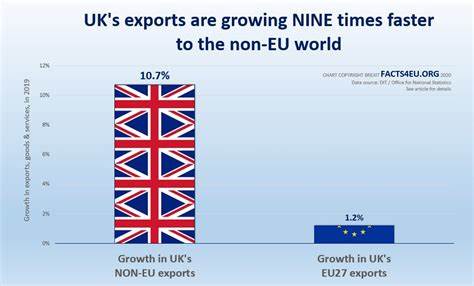Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft im Bereich satellitengestützter Internetdienste versucht China, mit zwei Mega-Satellitenkonstellationen, Guowang und Qianfan, eine ernsthafte Konkurrenz zu Elon Musks Starlink aufzubauen. Seit August 2024 hat China über 100 Satelliten für diese Netzwerke in den Orbit gebracht, mit dem Ziel, insgesamt rund 28.000 Satelliten in Betrieb zu nehmen. Dabei zeigen sich jedoch erhebliche Schwierigkeiten, die der fulminanten Expansion bisher im Weg stehen. Die beiden Projekte unterscheiden sich deutlich in ihrem Fokus.
Guowang, auch bekannt unter den Namen Xingwang oder SatNet, ist vor allem auf den heimischen Markt und nationale Sicherheitsanwendungen ausgerichtet. Qianfan, im Englischen auch Spacesail oder SSST genannt, strebt dagegen verstärkt internationale Märkte an und hat bereits Kooperationsverträge mit Ländern wie Brasilien, Malaysia und Thailand abgeschlossen. Weitere Märkte im asiatisch-afrikanischen Raum stehen in Aussicht. Im Vergleich zu Starlink, das bereits über 7.000 Satelliten betreibt, befinden sich die chinesischen Programme jedoch noch in einer frühen Phase ihrer Entwicklung.
Während die Ambitionen massiv sind, sind die tatsächlichen Fortschritte hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Technische Probleme und fehlende Transparenz erschweren die Bewertung der Leistungsfähigkeit der neuen Satelliten. Die chinesischen Betreiber veröffentlichen wenig Daten, weshalb die US Space Force über Radardaten eine der wenigen Informationsquellen darstellt. Besonders Qianfan kämpft mit einer ungewöhnlich hohen Ausfallrate unter seinen Satelliten. Von den 90 gestarteten Satelliten zeigten 13 Auffälligkeiten, etwa dass sie nicht ihre geplante Umlaufbahn erreichten.
Beim zweiten Start im Oktober 2024 erreichten nur fünf von 18 Satelliten die vorgesehene Höhe. Dies steht im Kontrast zu Starlink, wo die Anfangsausfallrate etwa drei Prozent betrug und mittlerweile auf unter 0,5 Prozent gesunken ist. Auch das britische OneWeb-Netzwerk verzeichnet mit über 600 Satelliten nur sehr wenige Ausfälle. Einer der Gründe für Qianfans Probleme könnte der Wechsel des Zulieferers auf Genesat sein, der erstmals eine größere Satellitenladung lieferte. Die mangelnde Erfahrung bei der Massenproduktion wird als wesentlicher Faktor für die Qualitätseinbußen vermutet.
Zudem setzen beide chinesischen Projekte auf höher gelegene Umlaufbahnen als Starlink, was zwar Vorteile in der Signalübertragung mit sich bringt, aber gescheiterte Satelliten schwieriger und länger im All verbleiben. Dies erhöht das Risiko der Weltraummüllbildung und erschwert die koordinierte Nutzung des orbitalen Raums. Die wachsende Anzahl von Satelliten verschiedener Betreiber führt zu logistischen Herausforderungen. Der Mangel an einem internationalen „Weltraum-Verkehrskontrollsystem“ bedeutet, dass die Satellitenbetreiber ständig Kollisionen vermeiden müssen. Dies verursacht zusätzliche Kosten und Verwaltungsaufwand, der sich negativ auf die Effizienz auswirkt.
Ein weiterer Hemmschuh für die chinesischen Mega-Netzwerke ist die Verfügbarkeit von Raketenstarts. Obwohl China zu den führenden Nationen bei Raketenstarts zählt, teilen sich viele Projekte die vorhandene Infrastruktur, einschließlich anderer Satellitenprogramme für Navigation oder Erdbeobachtung. Besonders problematisch ist das Fehlen einsatzbereiter, wiederverwendbarer Raketen, die bei Starlink für schnelle und kostengünstige Starts sorgen. Die chinesischen Unternehmen haben bereits öffentliche Ausschreibungen für Raketenservices veröffentlicht, blieben aber bisher ohne ausreichend Angebote. Neben den technischen und infrastrukturellen Schwierigkeiten spielen auch bürokratische Aspekte eine wichtige Rolle.
Guowang ist stark in staatliche Strukturen eingebunden und wird von Führungskräften aus großen Staatsunternehmen geleitet. Dies führt zu einem traditionellen und hierarchischen Führungsstil, der schnelle Entscheidungen und Flexibilität reduziert. Qianfan dagegen operiert modern und marktorientiert und hat Führungskräfte mit unternehmerischer Erfahrung eingestellt, was den Fortschritt beschleunigt. Die internationalen Marktchancen von Qianfan sind nicht zu unterschätzen. In vielen Ländern sorgt die politische Verflechtung von Elon Musk mit der US-Regierung für Skepsis gegenüber Starlink.
Beispielsweise wurden Starlink-Dienste in einigen Konfliktregionen, wie der Ukraine während des Kriegs, eingeschränkt. Zudem setzt Starlink seine Satelliten so ein, dass Daten ohne lokale Gateways übertragen werden können – ein Punkt, der bei einigen Staaten Bedenken bezüglich Datenkontrolle hervorruft. Qianfan hingegen bietet lokalen Telekommunikationsunternehmen die Kontrolle über den Datenverkehr an, was ein attraktives Argument für Regierungen sein kann, die Souveränität über ihre Netze wahren wollen. Der Ansatz von Qianfan, ausschließlich mit Telekomunternehmen zusammenzuarbeiten und keine direkten Endkundenservices anzubieten, soll Kooperationspartnern mehr Sicherheit geben. Viele Firmen, die mit Starlink kooperieren, beklagen den Verlust von Kunden, die Starlink direkt anspricht.
Qianfan vermeidet diese Problematik bisher gezielt. Dennoch steht der Uhrzeiger für beide chinesischen Projekte unter Druck. Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) verlangt, dass Unternehmen innerhalb von sieben Jahren nach der Registrierung mindestens ein erstes Satellitenpaar starten und innerhalb weiterer sieben Jahre regelmäßige Fortschritte nachweisen. Bis 2026 müssen zehn Prozent der geplanten Satelliten im Orbit sein, damit die Frequenzrechte erhalten bleiben. Angesichts des aktuellen Tempos ist fraglich, ob beide Projekte diese Vorgaben erfüllen können.