Die rasante Entwicklung und Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat Unternehmen weltweit vor neue Herausforderungen gestellt. Insbesondere große Unternehmen wie Kraft Heinz müssen nicht nur innovative KI-Lösungen entwickeln, sondern auch den tatsächlichen Wert ihrer Projekte messbar machen. Eine transparente und effektive Bewertung ist dabei entscheidend, um den Erfolg sicherzustellen und fortlaufend zu optimieren. Kraft Heinz hat hierfür einen ganzheitlichen Ansatz gewählt, der sowohl auf harte Zahlen als auch auf weiche Faktoren setzt. Im Folgenden soll erläutert werden, wie das Unternehmen KI-Projekte bewertet, welche Kriterien dabei eine Rolle spielen und warum dieser methodische Mix für nachhaltige Erfolge sorgt.
Zunächst betrachtet Kraft Heinz den quantitativen Aspekt der KI-Projekte. Ein wesentlicher Pfeiler ist hierbei die Business-Case-Bewertung. Diese Methode erlaubt es dem Unternehmen, KI-Anwendungen direkt mit den übergeordneten Unternehmenszielen zu verknüpfen. Ob es darum geht, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken oder Effizienzgewinne zu erzielen – jeder potenzielle Anwendungsfall wird dahingehend geprüft, welchen messbaren wirtschaftlichen Effekt er erzielen kann. Diese Herangehensweise schafft Transparenz und erlaubt fundierte Entscheidungen, welche Projekte tatsächlich einen Mehrwert für das Unternehmen darstellen.
Dabei stehen klare Kennzahlen im Mittelpunkt, die mit den Stakeholdern abgestimmt werden, um einen belastbaren Rahmen für den Projekterfolg zu definieren. Neben diesen hard facts spielt bei Kraft Heinz aber auch der qualitative Wert eine enorme Rolle. Das Unternehmen misst zum Beispiel die Auswirkungen auf den Net Promoter Score (NPS). Dieser Indikator zeigt an, wie zufrieden Kunden mit den Produkten und Services sind und wie wahrscheinlich es ist, dass sie die Marke weiterempfehlen. Mit Hilfe dieses Scores kann Kraft Heinz evaluieren, inwiefern KI-Initiativen tatsächlich eine positive Erfahrung für Konsumenten schaffen.
Ebenso wird die Adoptionsrate der neuen Technologien berücksichtigt. Ein Produkt oder eine Lösung kann noch so potenziell gewinnbringend sein, wenn es am Ende nicht breit im Unternehmen genutzt wird. Deshalb beobachtet Kraft Heinz eng die Nutzerbindung und das Engagement, um daraus Rückschlüsse über die Akzeptanz der Lösung zu ziehen. Das gleichzeitige Messen von quantitativen und qualitativen Parametern ist charakteristisch für den Erfolg von Kraft Heinz bei der Umsetzung von KI-Projekten. Dieser kombinierte Ansatz sorgt für eine ausgewogene Bewertung, bei der weder reine Zahlen noch subjektive Einschätzungen dominieren.
Stattdessen entstehen dadurch komplexe Erkenntnisse, die es ermöglichen, das Potenzial und die Herausforderungen der jeweiligen Initiative umfassend zu verstehen. So erhält das Management einen ganzheitlichen Überblick und kann den Einsatz von Ressourcen optimal steuern. Vor dem Start größerer KI-Investitionen steht bei Kraft Heinz eine sorgfältige Vorauswahl der Use Cases. Das Unternehmen nimmt sich die Zeit, potenzielle Anwendungen zu „pressure testen“. Dieser Prozess umfasst das Erarbeiten von Erfolgskriterien und das Erstellen von Mock-ups, also Prototypen, um erste praktische Erfahrungen zu sammeln.
Schon zu Beginn werden folgende Fragen intensiv diskutiert: In welche Richtung soll sich der Use Case entwickeln? Welche evolutionären Möglichkeiten bestehen? Wie kann der Erfolg messbar gemacht werden? Wie lassen sich Fortschritte kontinuierlich evaluieren? Diese detaillierte Vorarbeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass nur vielversprechende Projekte investiert werden. Es wird dadurch verhindert, dass Ressourcen in Ideen fließen, die im späteren Verlauf nicht den erwarteten Nutzen erbringen. Das Pressure Testing bildet somit eine wichtige Hürde, die für eine frühe Einschätzung und realistische Planung sorgt. Dabei steht nicht der reine KI-Einsatz an sich im Fokus, sondern die Rolle von KI als enabler, als wesentliche Zutat, die breite Programme und Strategien wirkungsvoll unterstützen kann. Kraft Heinz betrachtet KI deshalb nie als Allheilmittel, sondern als integrativen Bestandteil größerer Initiativen.
Die Bedeutung eines strategischen Alignments zeigt sich auch daran, dass die Projekte eng an den langfristigen Geschäftszielen ausgerichtet werden. Kraft Heinz weiß, dass der dynamische und kostenintensive KI-Markt viele Risiken birgt. Darum ist es entscheidend, dass die eingesetzten Use Cases nicht isoliert betrachtet werden, sondern in eine umfassende Strategie eingebettet sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass KI nicht zum Selbstzweck verkommt, sondern tatsächlich dazu beiträgt, nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Darüber hinaus ist die Einbindung der Unternehmensführung essenziell.
C-Suite, Vorstand und Investoren zeigen zunehmend Interesse an der Erfolgsmessung von KI-Projekten, was den Druck auf die Technologie-Experten weiter erhöht. Der strategische Dialog zwischen IT, Business und Führungsriege ist deshalb unerlässlich, um gemeinsam die richtigen Prioritäten zu setzen und Budgets zielgerichtet zu vergeben. Die klare Kommunikation von sowohl quantitativen Erträgen als auch qualitativen Verbesserungen stärkt das Vertrauen in die Digitalisierungsbemühungen und erleichtert die Akzeptanz im gesamten Konzern. Trotz des großen Potenzials bergen KI-Projekte weiterhin Risiken. Laut aktuellen Studien haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, den Geschäftswert von generativer KI zu belegen.
Kraft Heinz begegnet diesem Umstand mit einem disziplinierten Prozess der Erfolgsmessung und der Bereitschaft, Projekte nach klaren Kriterien zu bewerten und bei Bedarf auch nachzusteuern. Die Kombination aus Business Case, NPS-Feedback, Adoptionsmetriken und kontinuierlicher Fortschrittskontrolle hilft somit, Fallen frühzeitig zu erkennen und Projekte besser zu steuern. Nicht zuletzt wird in der KI-Strategie des Unternehmens der Lernprozess als fortlaufender Zyklus gesehen. Kraft Heinz misst nicht nur Erfolge, sondern versteht die gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage, um bestehende Systeme zu optimieren. Die kontinuierliche Überwachung von Nutzung und Werten führt zu einem lebendigen Feedbacksystem, das es erlaubt, Anwendungen flexibel an veränderte Marktbedingungen und technologische Fortschritte anzupassen.
So trägt das Unternehmen dazu bei, dass KI-Investitionen langfristig echten Mehrwert liefern und in der Praxis tatsächlich genutzt werden. Insgesamt zeichnet sich der Ansatz von Kraft Heinz durch eine klare Methodik aus, die technische Innovationen und Geschäftsergebnisse eng miteinander verbindet. Das Unternehmen setzt auf einen strukturierten Prozess von der Identifikation über die Bewertung bis hin zum Monitoring von KI-Projekten. Dabei sind sowohl harte Zahlen als auch weiche Faktoren entscheidend, um ein umfassendes Bild der Projekterfolge zu erhalten. Diese Vorgehensweise zeigt, wie sich Technologie mit konkretem Nutzen vereinen lässt und bildet eine wertvolle Orientierung für andere Unternehmen, die ihre KI-Strategien nachhaltig gestalten wollen.
Das Beispiel von Kraft Heinz macht deutlich, dass eine erfolgreiche KI-Implementierung nicht nur von der technischen Machbarkeit abhängt. Vielmehr sind eine sorgfältige Planung, klare Erfolgskriterien und eine ausgewogene Bewertung unerlässlich. Unternehmen, die diese Erkenntnisse berücksichtigen, haben bessere Chancen, die Potenziale von KI voll auszuschöpfen und auf einem zunehmend komplexen Marktumfeld konkurrenzfähig zu bleiben.




![Creating Refugees: Displacement Caused by the U.S.'s Post-9/11 Wars [pdf]](/images/E8556ABB-9D23-40B4-AE5B-54C2A95EB919)



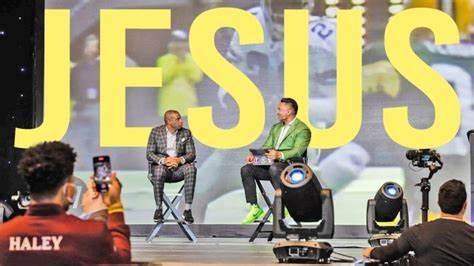
![The Plot to Kidnap and Assassinate Me [video]](/images/196ECB61-EA32-45AF-B88D-4241B7127E77)