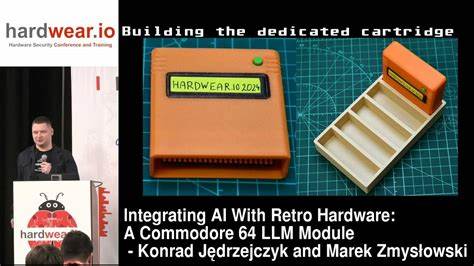Indoor-Klettersport erfreut sich wachsender Beliebtheit und zieht weltweit Millionen von Enthusiasten an. Doch die steigenden Besucherzahlen bringen neue Herausforderungen mit sich, die bisher wenig Beachtung fanden. Neben dem Risikomanagement beim Klettern selbst rückt nun die Qualität der Luft in den Blickpunkt – insbesondere die Belastung mit Gummi-Additiven, die aus den Sohlen der Kletterschuhe stammen. Obwohl Partikelbelastungen durch Chalk (Magnesiumcarbonat) gut bekannt sind, offenbart sich eine unterschätzte Gefahr durch Abrieb von Gummistoffen und den darin enthaltenen Chemikalien. Diese können nicht nur die Luftqualität beeinträchtigen, sondern auch gesundheitliche Konsequenzen für Kletterer und Beschäftigte in den Hallen haben.
Gummi-Additive finden sich in vielen Produkten, werden jedoch besonders in spezialisierten Kletterschuhen gezielt eingesetzt. Sie verbessern Flexibilität, Haftung und Abriebfestigkeit. Das Ziel: optimale Performance und Sicherheit für Kletterer. Doch genau diese Additive, sogenannte Rubber-Derived Compounds (RDCs), können durch den ständigen Kontakt zwischen Sohlen und Klettergriffen in die Umgebung verteilt werden. Reibung erzeugt feine Partikel, die sich auf den Tritten ablagern und bei der Reinigung oder mechanischer Bewegung erneut in die Atemluft gelangen.
Hierbei entstehen sowohl Aerosole als auch Staub, der sich im Raum verteilt. Umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass diese Gummi-Additive in der Luft und als Staubpartikel in Indoor-Kletterhallen in hohen Konzentrationen vorkommen. Besonders besorgniserregend ist die Konzentration bestimmter toxischer Verbindungen, wie 6PPD-Quinon, eine chemische Substanz, die als Abbauprodukt von Antioxidantien in Gummi gilt und bereits in Außenluft als gesundheitsschädlich eingestuft wurde. Die Vorteile, die Kletterschuhe bringen, bergen somit den Nachteil von potenziell gesundheitsschädlichen Emissionen, denen nicht nur Freizeitsportler ausgesetzt sind, sondern ganz besonders auch das Personal, das oft viele Stunden täglich in der halleninternen Luft arbeitet. Die Belastung durch Gummi-Additive ist nicht nur eine Frage der Partikelkonzentration, sondern auch ihrer chemischen Zusammensetzung.
Messungen in mehreren europäischen Kletterhallen belegen, dass die Konzentrationen von RDCs in Luftpartikeln und Staubproben um ein Vielfaches höher sind als in üblichen Innenräumen wie Wohnungen, Büros oder gar anderen Sporthallen. Besonderer Fokus liegt auf Verbindungen wie Benzothiazolen und phenylenediaminbasierten Verbindungen, die aus dem Gummi-Abrieb stammen und sich durch unterschiedliche Transformationen in der Raumluft verändern können. Der Prozess der Umwandlung dieser Verbindungen ist komplex. Frisch abgeriebene Partikel, die direkt vom Schuhsohlenabrieb stammen, enthalten eine andere Zusammensetzung als der in der Luft schwebende oder zu Boden gesunkene Staub. Durch Reaktionen, unter anderem mit Luftozon oder anderen oxidativen Stoffen, entstehen Transformationprodukte, die mitunter toxischer sind als die ursprünglichen Substanzen.
Besonders wurde nachgewiesen, dass 2SH-Benzothiazole sich in Benzothiazol und 2-Hydroxybenzothiazol umwandeln, während 6PPD zu 6PPD-Quinon oxidiert wird, welches gesondert für seine Lungentoxizität bekannt ist. Die Gesundheitsrisiken für Personen in diesen Atmosphären sind aktuell Gegenstand intensiver Forschung. Die inhalative Aufnahme von Partikeln mit RDCs kann sowohl obere als auch untere Atemwege erreichen und hier Entzündungen, oxidative Stresseffekte und sogar DNA-Schädigungen auslösen. Untersuchungen an Lungenzellen zeigen, dass spezifische Gummi-Abriebe Bestandteile toxisch wirken können. Dies wirft Fragen insbesondere im Hinblick auf die chronische Exposition bei Mitarbeitern auf, die täglich mehrere Stunden in diesen Hallen tätig sind.
Auch für Vielkletterer, die mehrmals wöchentlich und über längere Zeiträume die Hallen besuchen, ergeben sich relevante Expositionswerte. Neben der Gasphase, in der einige Gummi-Additive ebenfalls vorliegen können, wandert ein Großteil dieser Stoffe an Partikel und Staub. Dieser Staub wird durch Kletterer bei Bewegungen, etwa beim Abputzen der Griffe mit Bürsten oder beim Aufprall auf Matten, leicht aufgewirbelt und gelangt erneut in die Atemluft. Sämtliche dieser Quellen ergeben summiert eine nicht unerhebliche Belastung, die im Vergleich zur allgemeinen Belastung durch Chalk-Partikel mindestens ebenso relevant, wenn nicht sogar bedeutender ist, vor allem aufgrund der toxikologischen Eigenschaften der RDCs. Praktische Maßnahmen zur Reduzierung dieser Belastung stehen noch am Anfang.
Eine Möglichkeit ist die Optimierung der Belüftungstechnik in den Kletterhallen, um Partikel besser abzuführen und Frischluft zuzuführen. Aber auch bauliche Maßnahmen sowie die Einführung von staubbindenden Bodenbelägen könnten helfen. Die Auswahl von Kletterschuhen mit geringerem Additivgehalt oder eine Entwicklung alternativer Sohlenmaterialien ohne gesundheitlich bedenkliche Zusatzstoffe wäre ein strategischer Ansatz, der die Quelle der Belastung direkt adressiert. Nicht zuletzt sollten Betreiber und Nutzer von Kletterhallen über diese Risiken informiert werden. Sensibilisierung für die Tatsache, dass neben Chalkstaub auch Gummiabrieb gefährliche Substanzen freisetzen kann, ist entscheidend, um präventive Verhaltensweisen, wie schonendes Bürsten der Griffe und das Tragen von Schutzmasken bei besonders hoher Belastung während des Reinigens, zu fördern.
Gerade für die langfristig Exponierten kann der Schutz der Atemwege existenziell sein. Auch sind regulatorische Anforderungen denkbar, die ab einer bestimmten Partikel- oder Schadstoffkonzentration künftig Maßnahmen oder eine regelmäßige Überwachung vorschreiben könnten. Bisher existieren keine spezifischen Grenzwerte für Gummi-Additive im Innenraum, obwohl Studien wie diese die Handlungsbedürftigkeit unterstreichen. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Indoor-Klettersport nicht nur körperliche Fitness und gesundheitliches Wohl fördert, sondern auch unbewusst neue Umwelt- und Gesundheitsbelastungen mit sich bringen kann. Moderne Materialien und die nötige Funktionalität erzeugen zugleich Emissionen, deren Wirkung jetzt erst langsam erkannt wird.
Ein optimiertes Bewusstsein bei Herstellern, Betreibern und Kletterern sowie gezielte Forschung und präventive Maßnahmen sind daher unerlässlich, um Innenräume sicher und gesund zu gestalten. Damit der Sport auch in Zukunft mit seinem positiven Image verbunden bleibt, müssen auch solche unsichtbaren Risiken adressiert werden.