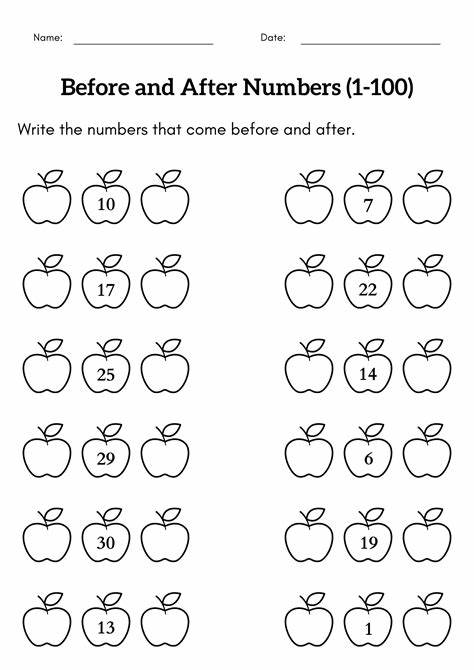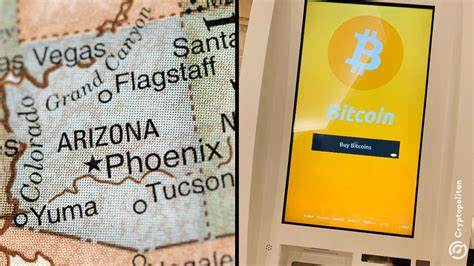In einer Welt, die von geopolitischer Unsicherheit geprägt ist und in der regionale Konflikte jederzeit eskalieren können, bereiten sich Fluggesellschaften und die Versicherungsbranche zunehmend auf die Möglichkeit eines nuklearen Zwischenfalls vor. Die jüngsten Spannungen in Konfliktregionen wie der Ukraine und Kaschmir verdeutlichen, dass ein Atomwaffeneinsatz nicht länger nur ein Szenario für den Kalten Krieg oder Hollywood-Filme ist, sondern eine reale Bedrohung darstellt, die alle Bereiche des zivilen Lebens tangieren kann – insbesondere den globalen Luftverkehr. Traditionell gingen Versicherungsrichtlinien dazu davon aus, dass ein atomarer Angriff automatisch das komplette Aus für den internationalen Flugverkehr bedeutet. Diese Annahme gründete sich auf die Angst vor einem umfassenden Dritten Weltkrieg, der nach einer einzigen nuklearen Detonation ausbrechen würde. Die daraus resultierende Entscheidung war, kurzfristig alle zivilen Flugzeuge weltweit zu landen, um Leben und Infrastruktur so gut wie möglich zu schützen.
Doch das Zeitalter der sogenannten taktischen Nuklearwaffen ändert dieses Bild grundlegend. Taktische Atomwaffen, die im Vergleich zu strategischen Kernwaffen deutlich geringere Sprengkraft besitzen und nur für begrenzte militärische Ziele eingesetzt werden sollen, verändern die Einschätzung der Risiken. So verfügen moderne Waffen wie die amerikanische B61-Bombe über eine Sprengkraft von nur 0,3 Kilotonnen, während die Hiroshima-Bombe rund 15 Kilotonnen aufwies. Die atomwaffenpolitischen Entwicklungen in Russland, mit tausenden taktischen Einheiten im Arsenal, Nordkoreas neuen Demonstrationen derartiger Systeme sowie die Spannungen zwischen Indien und Pakistan mit ihrer Nasr-Rakete verdeutlichen die steigende Wahrscheinlichkeit von kleineren Nuklearkonflikten im regionalen Rahmen. Dieser Wandel hat die Versicherungsbranche dazu veranlasst, ihre Modelle und Vertragsbedingungen neu zu gestalten.
Gallagher, der weltweit größte Versicherungsmakler für die Luftfahrtindustrie, arbeitet seit dem Jahr 2022 intensiv daran, Versicherungsprodukte zu entwickeln, die Flüge auch nach einem atomaren Zwischenfall weiterhin ermöglichen könnten – zumindest in geografisch sicheren Regionen, die nicht unmittelbar vom Konflikt betroffen sind. Mit einer sich verändernden Risikolandschaft ist es für Fluggesellschaften und Versicherer wichtig, zwischen den Szenarien einer großflächigen Katastrophe und einem begrenzten taktischen Einsatz zu differenzieren. Die praktischen Herausforderungen sind enorm, denn der Flugverkehr ist heute ein integraler Bestandteil der globalen Wirtschaft. Weltweit transportieren Flugzeuge jährlich Milliarden von Passagieren und unentbehrliche Güter. Ein pauschales Grounding, also eine flächendeckende Landung aller Flugzeuge nach einer nuklearen Explosion, wäre wirtschaftlich katastrophal und könnte weltweite Lieferketten zum Erliegen bringen.
Daher wird der Ansatz verfolgt, eine differenzierte Risikobewertung vorzunehmen, in der spezialisierte Expertengruppen auf Basis aktueller Sicherheitsinformationen schnell entscheiden, welche Flugrouten und Flughäfen weiterhin sicher genutzt werden können. Diese Expertengremien, die unter anderem von Versicherern wie Allianz unterstützt werden, sollen im Ernstfall innerhalb weniger Stunden nach Detonation zusammenkommen und eine fundierte Einschätzung abgeben. Dabei fließen umfangreiche Daten von Risikomanagement-Unternehmen wie Osprey Flight Solutions ein, die Bedrohungen für Luftfahrt und Lufträume analysieren. Ergebnis dieser Bewertung ist eine zielgerichtete Freigabe von Flügen, beschränkt auf sichere Regionen, um den Luftverkehr trotz widriger Umstände aufrechtzuerhalten. Natürlich hat diese Neuausrichtung der Versicherungen auch finanzielle Auswirkungen.
Allerdings soll die Abdeckung der neuen Risikoszenarien vergleichsweise kostengünstig bleiben. Laut Aussagen von Gallagher entspräche der Aufpreis pro Passagier weniger als dem Preis einer Tasse Kaffee. Diese moderate Erhöhung erscheint angesichts der potenziellen Vorteile vertretbar. Die neue Versicherungspolitik sieht eine Deckung von etwa einer Milliarde US-Dollar pro Flugzeug im Bereich Kriegsschäden vor, was zwar weniger ist als frühere Deckungen, aber dennoch umfangreichen Schutz für Passagiere und Dritte bietet. Bislang haben rund 100 Fluggesellschaften weltweit den neuen Bedingungen zugestimmt, darunter etwa 60 europäische Unternehmen.
Allerdings hadern besonders günstigere Fluglinien mit dieser zusätzlichen Versicherung, was vermutlich auf Kostendruck und Risikobewertungen zurückzuführen ist. Weitere Herausforderungen bestehen durch sogenannte „Five Powers War Clauses“ in Versicherungsverträgen, die eine Deckung ausschließen, wenn militärische Auseinandersetzungen zwischen Großmächten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China stattfinden. Diese Klauseln könnten sich bei einer Eskalation im Rahmen internationaler Militäroperationen relevant zeigen und dennoch zum Herunterfahren des Flugbetriebs führen. Neben den Versicherungsfragen müssen sich Fluggesellschaften auch operativ wappnen. So wird überlegt, sichere Flugkorridore zu etablieren, die weit genug von aktiven Konfliktzonen entfernt sind.
Flugrouten und Flughöhen könnten so gewählt werden, dass Flugzeuge außerhalb der Reichweite von Boden-Luft-Raketen bleiben. Ähnlich wie bei den Herausforderungen durch Vulkanausbrüche oder andere Naturkatastrophen demonstriert die Luftfahrtbranche hier ihre Fähigkeit, sich flexibel an gefährliche Umstände anzupassen. Auch wenn das Szenario eines nuklearen Konflikts beängstigend erscheint, zeigt die Rückkehr von entsprechenden Versicherungsprodukten und Sicherheitskonzepten, wie entschlossen die Luftfahrt ist, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Je weiter technische Möglichkeiten und geopolitische Risiken sich entwickeln, desto wichtiger wird es, realistische Erwartungshaltungen für Flugsicherheit und Wirtschaftlichkeit zu schaffen. Für Passagiere bedeutet dies, dass trotz unsicherer Zeiten Flugreisen weiterhin möglich bleiben sollen, sofern die Risiken verantwortungsvoll eingeschätzt werden.