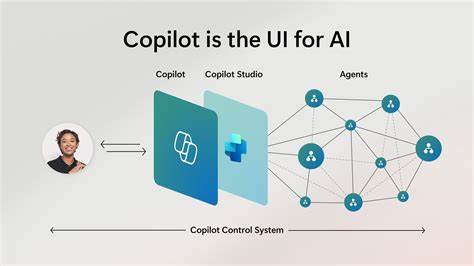Die Energiewende verändert nicht nur die Art und Weise, wie Energie erzeugt wird, sondern stellt auch hohe Anforderungen an das Management und die Steuerung der Stromnetze. Elektromobilität, erneuerbare Energien und dezentrale Erzeugung führen dazu, dass Millionen von kleinen Erzeugern und Verbrauchern – sogenannte Distributed Energy Resources (DER) – miteinander kommunizieren und gesteuert werden müssen. In vielen aktuellen Netzprotokollen werden zur Steuerung der Geräte lediglich Strompreise übermittelt, mit der Hoffnung, dass die Geräte selbst entscheiden, wann sie Energie beziehen oder einspeisen. Doch diese Herangehensweise stößt heutzutage an ihre Grenzen und reicht nicht aus, um die Komplexität und Dynamik moderner Energiesysteme zu bewältigen. Ein tieferer Blick in die Problematik offenbart, warum das Senden von Strompreisen an Geräte alleine nicht genügt und welche Lösungsansätze zukünftig erfolgreich sein können.
Im Zentrum der aktuellen Herausforderungen steht die schiere Größe und Flexibilität der Stromverbraucher, insbesondere der Elektrofahrzeuge (EVs). Allein in den USA gibt es rund 250 Millionen Fahrzeuge, von denen erwartet wird, dass sie mittelfristig alle Elektrofahrzeuge sein werden. Jedes dieser Fahrzeuge wird an einem Level-2-Ladegerät angeschlossen sein, das durchschnittlich eine Leistung von etwa 22 Kilowatt aufweisen kann. Zusammengenommen ergibt dies eine potenzielle Leistung von rund 5,5 Terawatt – eine Menge Energie, die vergleichbar mit dem Output von 55 amerikanischen Kernkraftwerken ist. Diese riesige „Batterie“ steht im privatem Umfeld, in Garagen und an Ladestationen bereit und könnte theoretisch zur Stabilisierung des Stromnetzes genutzt werden.
Die Frage lautet, wie sich diese Millionenschar von Geräten effizient und sicher steuern lässt. Bisherige Netzwerkprotokolle wie OpenADR, EEBus, OCPP und jüngere wie das Energy Protocol oder Matter setzen vor allem auf das Prinzip, Preise an Geräte zu übermitteln, die dann autonom auf diesen Anreiz reagieren sollen. Im Kern funktioniert dieses Modell so, dass Preislisten mit Zeitstempeln an die Geräte geschickt werden. Wenn der Strompreis zu bestimmten Zeiten besonders niedrig ist, können die Geräte Strom beziehen, wenn er hoch ist, reduzieren sie ihren Verbrauch oder geben gespeicherte Energie ins Netz zurück. Auf den ersten Blick klingt das nach einem effektiven Marktmechanismus, der die dezentrale Steuerung erleichtert und Lastspitzen glättet.
Doch die Praxis zeigt ein ganz anderes Bild. Das Hauptproblem bei der Übermittlung von reinen Strompreisen ohne Mengenbegrenzung ist die Annahme, dass Geräte unbegrenzt auf den Preis reagieren können. Wenn beispielsweise allen Elektrofahrzeugen in einer Region zu einer bestimmten Stunde preislich signalisiert wird, dass der Strom besonders günstig ist, reagieren alle gleichzeitig – die Folge ist eine massive Lastspitze, die das Netz überfordern könnte. Dies führt zu einem „Stampede“-Effekt, bei dem die Gesamtnachfrage unkontrolliert ansteigt und die eigentliche Flexibilität verloren geht. Um diese Last zu verteilen, müsste man die Gruppe der Verbraucher so weit fragmentieren, dass individuelle Preislisten versendet werden, was den Steuerungsaufwand und die Komplexität enorm erhöht und den Vorteil der Marktmechanik zunichte macht.
Ein weiteres Dilemma entsteht durch die unvorhersehbaren Ereignisse im Netz, zum Beispiel wenn ein großes Kraftwerk unerwartet ausfällt. Geplant war, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Last auf einem günstigen Preisniveau verlagert wird. Fällt die Erzeugung aus, muss kurzfristig Last reduziert werden. Doch wie reagiert man auf diese Situation, wenn die Preise bereits versendet und von den Geräten angenommen wurden? Eine nachträgliche Preisänderung ist problematisch, weil viele Geräte möglicherweise die aktualisierten Preislisten nicht empfangen oder schon ihre Last verschoben haben. Geräte, die ihre Flexibilität bereits genutzt haben, gehen leer aus oder werden im schlimmsten Fall bestraft, weil sie auf falsche Preisinformationen reagierten.
Dieses Szenario verdeutlicht, dass starre Preislisten ohne Mengenangaben und ohne Möglichkeit zur Echtzeit-Anpassung den Anforderungen einer dynamischen Netzsteuerung nicht genügen. Zudem entspricht das aktuelle Vorgehen nicht den Funktionsweisen etablierter Märkte. In tatsächlichen Märkten – sei es Energie-, Aktien- oder Einzelhandelsmärkte – gibt es immer eine Kombination aus Preis und Menge. Niemand kann unbegrenzt zu einem festen Preis einkaufen oder verkaufen. Die Preise ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage innerhalb definierter Mengen.
Dieses Zusammenspiel sorgt für eine marktgerechte Steuerung und verhindert Überlastungen oder Versorgungsengpässe. Im Energiesektor sind die bestehenden Spotmärkte in Europa und anderswo zwar fortschrittlich, arbeiten aber nicht in Echtzeit für den Endverbraucher. Die Preise für den Großhandel werden meist schon am Vortag oder in Intervallen festgelegt und können nicht flexibel und granular genug auf Millionen von kleinen Verbrauchern angepasst werden. Auch die Tatsache, dass viele Energieversorger in der Vergangenheit noch überwiegend starre Tarifmodelle angeboten haben, wo die Preise für Strom über längere Zeiträume konstant bleiben, erschwert die Nutzung von Flexibilität. Zwar gibt es variable Tarife und Spotpreise im Handel, doch diese sind häufig zu grob getaktet oder verfügen nicht über die erforderliche Feinsteuerung, um Spitzenlasten effektiv zu reduzieren oder auf plötzliche Ereignisse zu reagieren.
Wesentlich effizienter ist die Umsetzung von Marktmechanismen, die Preisbildung und Mengensteuerung dynamisch miteinander verbinden. In großen Energiesystemen erfolgt dies meist über Auktionen, bei denen Angebot und Nachfrage über Gebote für bestimmte Energievolumina zusammengeführt werden. Solche Auktionen existieren als Tagesmarkt (Day-Ahead-Markt), bei dem der Preis basierend auf prognostizierten Angeboten und Nachfragen für einzelne Zeitintervalle festgelegt wird, sowie als Intraday-Markt, der kontinuierliche Handelsszenarien und Nachsteuerungen ermöglicht. Ein Protokoll für die dezentrale Steuerung von Millionen von Geräten müsste diese Prinzipien übernehmen und in angepasster Form für kleinteilige Verbraucher zugänglich machen. Statt fester, unbegrenzter Preissignale sind klare Mengenbegrenzungen und dynamische Angebote nötig, mit denen sich Geräte kurzfristig auf aktuelle Netzbedingungen einstellen können ohne Überlastungsrisiken.
Dies könnte durch kontinuierliche Auktionsmechanismen oder nodale Preisbildung innerhalb lokal begrenzter Netzgebiete erfolgen, wobei sich Angebot und Nachfrage in Echtzeit abstimmen. Die Herausforderungen einer solchen Umsetzung sind komplex. Es bedarf moderner Kommunikationstechnologien, performanter Algorithmen für die Marktabwicklung und zuverlässiger Endgeräte, die in der Lage sind, Marktmechanismen automatisiert und sicher umzusetzen. Ein großer Vorteil ist, dass hier kein zentraler „Diktator“ mehr die Steuerung übernimmt, sondern Geräte auf Basis ihrer individuellen Präferenzen, Bedürfnisse und Einschränkungen eigenständig entscheiden können, ob sie ein Angebot annehmen. Dies erhöht die Effizienz, fördert den Wettbewerb und ermöglicht eine bessere Einbindung von erneuerbaren Energien und Energiespeichern.
Es ist klar, dass die bisherige Praxis, lediglich Strompreis-Listen mit unendlicher Angebotsmenge an Geräte zu senden, in einer zunehmend dezentralisierten und elektrifizierten Welt nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die Umstellung auf marktähnliche Steuerungen mit abgestimmten Preis- und Mengeninformationen ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um die Energieversorgung zukunftssicher, flexibel und stabil zu gestalten. Nur so kann das riesige Potenzial der Millionen Elektrofahrzeuge und anderer flexibler Verbraucher nachhaltig genutzt werden, um Lastspitzen zu glätten, Netzausfälle zu verhindern und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien zu maximieren. Der Energiesektor steht daher kurz vor einer Paradigmenverschiebung. Hersteller von Steuerprotokollen und Energiemanagementsystemen sind gefordert, ihre Konzepte grundlegend zu überdenken und Lösungen zu entwickeln, die dem hohen Tempo und der Dynamik heutiger Stromnetze gerecht werden.
Mit intelligenten Marktmechanismen, die Echtzeitanpassungen ermöglichen und neben Preisen auch Mengen begrenzen, eröffnet sich eine neue Ära der Netzsteuerung – eine Ära, die auf Kooperation von Millionen Verbrauchern, Erzeugern und dem Netz basiert und die Energieversorgung endlich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.
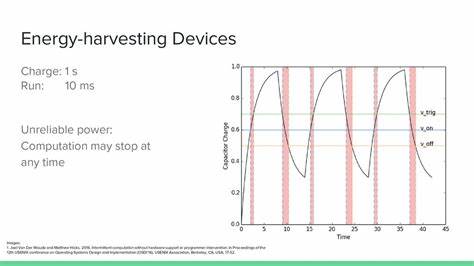



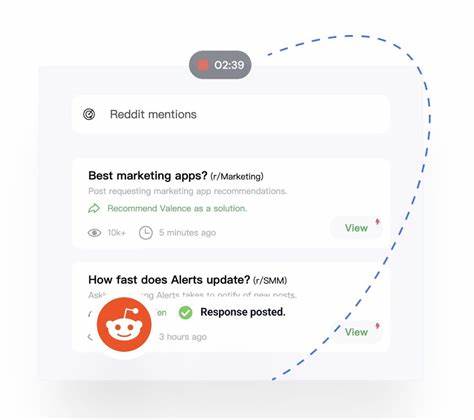



![Night Mail (1936) [video]](/images/908A9A9C-683B-4068-BE26-97B2E4A1957B)