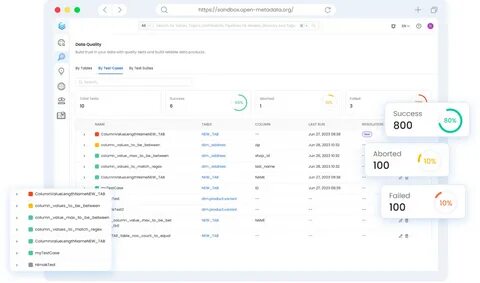Das Bild von mittelalterlichen und renaissancezeitlichen Bauern, die lediglich in eintönigen und langweiligen Farben wie Braun, Grau oder Schwarz gekleidet waren, hält sich hartnäckig bis heute. Dieses stereotype Verständnis stammt oft aus modernen Missverständnissen und antiquierten Vorstellungen von sozialer Schichtung und materiellen Möglichkeiten vergangener Epochen. Doch bei genauerer Betrachtung zeigen historische Quellen, dass die bäuerliche Bevölkerung keineswegs farblos oder monoton gekleidet war. Im Gegenteil – Farben spielten auch in den einfachen Schichten der Gesellschaft eine bedeutende Rolle und zeugen von einem überraschenden Maß an Vielfalt und Lebendigkeit. Die Erforschung dieses Themas stützt sich maßgeblich auf Gemälde, illuminierte Handschriften, schriftliche Aufzeichnungen und archäologische Funde, die zusammengenommen ein viel facettenreicheres Bild ergeben, als man vielleicht vermuten würde.
In vielen Darstellungen des Mittelalters und der Renaissance begegnet man Bauern und Armen, die durchaus in farbige Kleidungsstücke gehüllt sind. Eine populäre Ikonographie sind neben religiösen Szenen besonders solche, die die Verteilung von Almosen zeigen. Künstler wie Fra Angelico im 15. Jahrhundert haben mehrfach Szenen von Heiligen dargestellt, die den Armen und Bedürftigen Hilfe leisten. Im Hintergrund solcher Gemälde und Handschriften findet man oft Figuren, die deutlich als bäuerliche oder arme Bevölkerung erkennbar sind und dennoch farbige Gewänder tragen.
Die Farbpalette reicht dabei von gedeckten Blau- und Grüntönen über verschiedene Rottöne bis hin zu zarten Rosa- und Lavendeltönen, was das Bild einfacherer Menschen in bunten Kleidern unterstreicht. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Werk "St. Stephen Distributing Alms" von Fra Angelico aus den 1440er Jahren. Hier sind die bedürftigen Menschen in unterschiedliche Farben gekleidet: eine Frau in einem pfirsichfarbenen Kleid mit einem hellblauen Halstuch, ein Kind in einer gedämpften Mauve-Tunika und ein Mann in einem blauen Gewand. Obwohl diese Farben nicht extrem leuchtend sind, heben sie sich deutlich von einem graubraunen oder vollkommen monochromen Gesamtbild ab.
Wenige Jahre später zeigt Fra Angelico in "Saint Lawrence giving alms" ähnliche Farbgebungen mit Farbtönen wie sattes Rot, Altes Grün und Burgund, selbst bei armen Personen. Diese Beispiele widerlegen eindeutig das Vorurteil, dass Farbigkeit allein der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten war. Noch farbprächtiger wirken Szenen wie „Catherine of Cleves Distributing Alms“ vom Meister des gleichen Namens um 1440. In diesem illuminierten Manuskript trägt die abgebildete Figur des Bettlers einen strahlend blauen Doppeltzeitrock und sogar einen orangefarbenen Stiefel. Ein anderer Bettler ist mit einem grünen Jackett mit eingesetzten rosa Kragen und Manschetten bekleidet.
Trotz der offensichtlichen Gebrauchsspuren und Flickstellen an der Kleidung sind diese Farben intensiv und lebendig. Neben Grau und Braun treten satte Blautöne, Pink und Orange auf – insgesamt ein Farbenspiel, das weit entfernt von der Vorstellung schlichter, eintöniger Kleidung liegt. Auch in anderen Werken, wie etwa bei Darstellungen der sogenannten „Alms of St. Anthony“ von Lorenzo Lotto im 16. Jahrhundert, finden sich Farben wie Grün, Gelb, Orange und Rot bei den einfachen Leuten.
Diese Vielfalt ist in ihrer Mischung vergleichbar mit der heute üblichen Straßenkleidung. Es offenbart sich zudem ein spezielles Farbensemble mit häufigen Blautönen und Rottönen, die offenbar auch für weniger betuchte Träger zugänglich und beliebt waren. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Darstellung von Hirten, welche als typische Vertreter der Arbeiterklasse in der mittelalterlichen Gesellschaft gelten. Hirten erscheinen gerne in Kunstwerken als Beispiele bäuerlicher Alltagskultur und sind zumeist nicht wohlhabend. Trotzdem finden sich gerade hier durchweg bunte Farbtöne.
In der Miniatur „Adoration of the Shepherds“ aus der Zeit zwischen 1450 und 1475 aus Belgien sind Bekleidungen mit Mischfarben zu sehen: ein Hirte trägt unterschiedliche Hosen mit Rot, Gelb und Blau, während eine Frau im Hintergrund ein sattes Rot trägt. Solche Kombinationen zeigen, dass Farbigkeit im bäuerlichen Kleidungsstil keineswegs außergewöhnlich war. Der Gebrauch von Rot und Blau bei der bäuerlichen Bevölkerung wird zudem durch weitere Handschriften illustriert. In den Heures à l'usage de Rome beispielsweise wird eine Wächterin der Schafe in leuchtendem Rot und Blau dargestellt. Auch im Livre d’heures du Maître du Bréviaire de Jean sans Peur sind Farbtöne von Rot und Blau präsent, nebst Erdtönen wie Braun.
Diese Farbkombinationen ergeben sich wohl aus der Verfügbarkeit der damals häufigsten natürlichen Farbstoffe wie Krappwurzel (für Rot) und Waid (für Blau). Die technische Grundlage für diese Farbvielfalt lag in den verwendeten natürlichen Farbstoffen und deren regionaler Verfügbarkeit. Während teure und knappe Farbstoffe wie karmesinrot und indigoblau der Oberschicht vorbehalten blieben, waren die Grundfarben Rot und Blau durchaus auch für ärmere Bevölkerungsschichten erschwinglich, wenn auch in etwas einfacheren Qualitäten und Farbabstufungen. Manche Gras- und Wurzelfarben erlaubten das Färben von gedeckten Gelb-, Grün- und Orangetönen. Selbst ausgefallenere Farbnuancen wie ein dezentes Rosa, ein sanftes Lila oder ein Orangeton finden sich in den Darstellungen der damaligen Zeit, unter anderem in den mit großer Sorgfalt gefertigten Buchmalereien.
Die dunklere Vorstellung, dass Bauern und Arme vor der Erfindung der chemischen Farbstoffe im 19. Jahrhundert nur rauhe Stoffe in langweiligen Brauntönen tragen konnten, basiert eher auf späteren Industrialisierungs- und Wirtschaftsverhältnissen als auf den einstigen mittelalterlichen Lebensrealitäten. Immerhin besaßen Bauern Gemeinschaften oftmals eine lokale Wollverarbeitung und konnten auf einfache natürliche Färbungen zurückgreifen. Die auszuwählende Farbpalette war zwar durch ökonomische Gegebenheiten eingeschränkt, aber keineswegs auf das Minimalistische reduziert. Die zahlreichen erhaltenen Gemälde und Handschriften, die sich mit dem Alltag und dem sozialen Gefüge der unteren Bevölkerungsschichten beschäftigen, widerlegen eindeutig das Bild des unifarbenen, graubraunen bäuerlichen Kleidungsstils.
Ebenso bestätigen schriftliche Quellen, dass farbige Kleidung auch von einfachen Leuten getragen wurde, wenn nicht in sattem Purpur oder tiefem Indigo, dann doch in Grün-, Blau- oder Rottönen. Auch archäologische Fundstücke aus der mittelalterlichen Zeit liefern spannende Einblicke in Farben und Stoffe bäuerlicher Kleidung. Textilfasern, Farbreste auf Überresten von Kleidung sowie Färberarbeiten aus damaligen Werkstätten zeigen eine erstaunliche Farbvielfalt. Diese Beweise ergänzen die bildlichen und schriftlichen Quellen und verdeutlichen, dass Farbe im Mittelalter und in der Renaissance nicht allein ein Privileg der reichen Elite war. Zusammenfassend zeigt sich, dass die bäuerliche und ärmere Bevölkerung des Mittelalters und der Renaissance keineswegs zwangsläufig in eintönigen und langweiligen Farben gekleidet war.