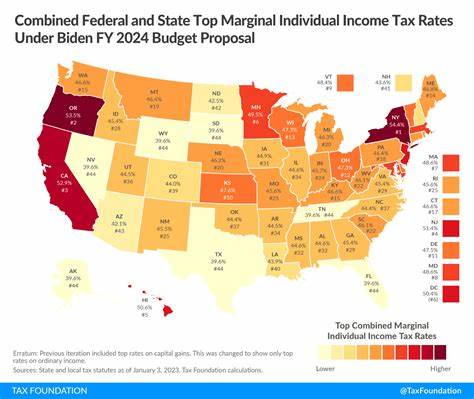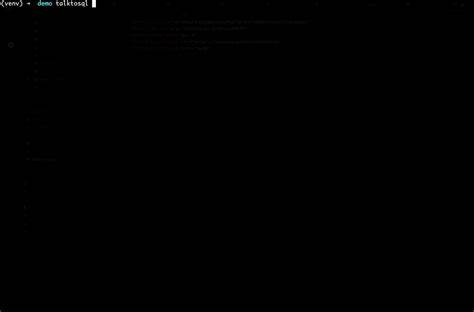Die steuerliche Sonderbehandlung von Kreditgenossenschaften ist seit Jahrzehnten ein kontrovers diskutiertes Thema innerhalb der Finanz- und Politiklandschaft der Vereinigten Staaten. Die jüngsten Entwicklungen im Rahmen des Haussteuer- und Ausgabengesetzes haben diese Debatte weiter entfacht, da das Gesetz die bestehende Befreiung von der Einkommenssteuer für Kreditgenossenschaften fortsetzt. Trotz der wachsenden Konkurrenz zwischen Banken und Kreditgenossenschaften sowie der zunehmenden Übernahmen von Banken durch Kreditgenossenschaften bleibt die Steuerbefreiung ein entscheidender Faktor für den Wettbewerb und die Marktstruktur. Diese Analyse widmet sich den Details dieser Steuerregelung, den ökonomischen und politischen Hintergründen, der Entwicklung des Kreditgenossenschaftensektors und den Herausforderungen, die sich daraus für Regulierung und Steuergesetzgebung ergeben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen dieser Regelungen auf Banken, Kreditgenossenschaften und die Verbraucher in den USA.
Die steuerliche Sonderstellung von Kreditgenossenschaften ist historisch gewachsen und entstand in den Zeiten der Großen Depression. Ziel dieser Befreiung war es ursprünglich, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für einkommensschwache und arbeitende Bevölkerungsgruppen zu erleichtern. Kreditgenossenschaften wurden damals als nichtgewinnorientierte Organisationen konzipiert, die Mitglieder mit einem gemeinsamen Bezug, wie etwa einem Arbeitsplatz, zusammenschließen, um untereinander finanzielle Dienstleistungen anzubieten. Diese Einschränkungen wurden im Laufe der Jahre zunehmend gelockert. Mittlerweile agieren Kreditgenossenschaften weitgehend ähnlich wie Banken, bieten vergleichbare Dienstleistungen an und wetteifern um die gleichen Kundengruppen.
Der Wesensunterschied ist, dass Kreditgenossenschaften – anders als Banken – keine Bundeseinkommenssteuer zahlen müssen. Für viele Beobachter entsteht hierdurch eine unfaire Wettbewerbssituation, da Banken als gewinnorientierte Unternehmen regulär besteuert werden, während Kreditgenossenschaften diese Belastung in ihrer Bilanz nicht berücksichtigen müssen. Die Ausweitung der Tätigkeitsfelder und des geographischen Wirkungskreises von Kreditgenossenschaften führte zu ihrem erheblichen Wachstum in den letzten Jahren. Seit 2014 haben sich die Gesamtvermögenswerte von Kreditgenossenschaften auf mittlerweile rund 2,3 Billionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung ist zum Teil auf die Lockerung der ursprünglichen Beschränkungen zurückzuführen, durch die Kreditgenossenschaften Kooperationen über ihre ursprünglichen Mitgliedschaftsgruppen hinaus eingehen können.
Dieser Umstand ermöglicht es ihnen, Risiken breiter zu streuen und ihr Geschäft auszubauen. Im Zuge dieses Wachstums haben Kreditgenossenschaften ihre Strukturen konsolidiert und deutlich an Größe gewonnen. Die durchschnittlichen Vermögenswerte pro Kreditgenossenschaft sind seit 2014 um über 100 Prozent gestiegen, was zeigt, dass kleinere Einheiten vielfach in größere integriert wurden. Ein weiterer Trend, der vor allem die traditionelle Bankenwelt verändert, ist der zunehmende Kauf von Banken durch Kreditgenossenschaften. Seit 2011 sind mehr als 100 solcher Übernahmen bekannt geworden, darunter allein im vergangenen Jahr 22.
Diese Expansion findet regional unterschiedliche Akzeptanz. Bundesstaaten wie Alabama, Florida und Michigan verzeichnen den Großteil der Übernahmen, während einige andere Bundesstaaten von diesen Entwicklungen eher kritisch berichten und neue Regulierungs- oder Steuermaßnahmen prüfen, um Effekte auf ihren Märkten abzufedern. Die steuerlichen Einnahmeverluste aufgrund der Einkommenssteuerbefreiung von Kreditgenossenschaften sind beträchtlich. Nach aktuellen Schätzungen des US-Finanzministeriums reduzieren diese Ausnahmeregelungen die Bundessteuereinnahmen in den kommenden zehn Jahren um etwa 32 Milliarden US-Dollar. Die Joint Committee on Taxation (JCT) geht von noch höheren Kosten in der Größenordnung von 39 Milliarden Dollar aus, wenn man eine leicht längere Betrachtungsperiode einbezieht.
Angesichts dieser Zahlen wird in Finanz- und Politikerkreisen gefordert, die Steuerbefreiung grundlegend zu überdenken oder gar abzuschaffen. Das aktuelle Hausgesetz geht jedoch nicht diesen Weg, sondern setzt stattdessen auf indirektere Maßnahmen. Eine davon ist die Ausweitung der Anwendung einer bereits existierenden Luxussteuer auf Vorstandsgehälter in steuerbefreiten Organisationen. Seit der Reform des Steuergesetzes 2017 unter dem Titel Tax Cuts and Jobs Act gilt für die fünf bestbezahlten Angestellten jeder steuerbefreiten Organisation eine 21-prozentige Luxussteuer auf Vergütungen über einer Million US-Dollar. Diese Regel soll sowohl Einkünfte aus Gehältern als auch sogenannte Abfindungen umfassen.
Mit der Novellierung im aktuellen Hausgesetz wird diese Steuer auf alle vor- und ehemalige Mitarbeiter ausgeweitet, nicht mehr nur auf die Top-Fünf. Die geschätzten Einnahmen aus dieser Maßnahme belaufen sich auf etwa 3,8 Milliarden Dollar über die kommenden zehn Jahre, insbesondere aus dem Bereich der großen gemeinnützigen Einrichtungen wie Hochschulen und Krankenhäuser. Parallel hierzu verschärft das Gesetz auch die Beschränkungen im Sektor der öffentlich gehandelten Unternehmen, zu denen auch Banken zählen. Hier gilt seit 2017 eine Regelung, die die steuerliche Abzugsfähigkeit von Gehältern über einer Million für die zehn bestbezahlten Führungskräfte beschränkt. Das Hausgesetz sorgt mit einer Erweiterung der Konzerngesellschaften für eine erwartete Mehreinnahme von 15,7 Milliarden US-Dollar über einen ähnlichen Zeitraum.
Diese sogenannten Kompensationssteuern trifft jedoch nicht nur Kreditgenossenschaften, sondern auch konventionelle Banken. Kritik an diesen Regelungen gibt es von Experten, die darauf hinweisen, dass die komplexen Vorschriften viele Schlupflöcher aufweisen, durch die Unternehmen und Organisationen trotz des Gesetzes hohe Vergütungen zahlen können. Ebenso sei die Verwaltung dieser Steuern aufwendig und wenig effizient. Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist die Willkürlichkeit und nicht neutrale Ausgestaltung. Es ist fraglich, ob durch diesen Ansatz tatsächlich die im Gesetz veranschlagten Steuereinnahmen dauerhaft und gerecht erzielt werden können.
Für viele Fachleute wäre eine grundlegendere Reform zielführender. Dazu zählt insbesondere die Forderung, die vollständige Einkommenssteuerbefreiung für Kreditgenossenschaften zu hinterfragen oder ganz abzuschaffen. Die Logik dahinter ist, dass diese mittlerweile große und zunehmend ähnlich zu Banken arbeitende Unternehmen auch steuerlich gleichbehandelt werden sollten. Dies würde nicht nur für mehr Fairness zwischen Banken und Kreditgenossenschaften sorgen, sondern auch einen erheblichen zusätzlichen Beitrag zur Staatseinnahmeseite leisten, der im aktuellen Budget stark benötigt wird. Darüber hinaus würde eine solche Angleichung die regulatorischen und steuerlichen Spielräume abschaffen, die Kreditgenossenschaften derzeit erlauben, aggressive Expansionen und Übernahmen von Banken vorzunehmen, was einige Marktbeobachter kritisch sehen.
Aus Sicht der Verbraucher ist die aktuelle Situation ambivalent. Kreditgenossenschaften sind oft lokal verankert und gelten als verbraucherfreundlicher, gerade für einkommensschwächere Gruppen. Ihre steuerlichen Vorteile ermöglichen ihnen günstigere Konditionen anzubieten. Allerdings führt die stark expandierende Größe und Kommerzialisierung vieler Kreditgenossenschaften dazu, dass sie sich immer weniger von herkömmlichen Banken unterscheiden und stattdessen dieselben Marktmechanismen und Wettbewerbsstrategien nutzen. Dies wirft die Frage auf, ob der ursprünglich angestrebte soziale Zweck der Kreditgenossenschaften weiterhin erfüllt wird.
Insgesamt steht die US-Finanzwelt vor der Herausforderung, zwischen Fairness im Wettbewerb, Einnahmeerzielung für den Staat und dem Schutz der Verbraucherinteressen abzuwägen. Die Fortsetzung der Steuerbefreiung im aktuellen Haussteuer- und Ausgabengesetz unterstreicht die Komplexität und politische Sensibilität dieses Themas. Künftige politische Entschlüsse müssen diese Dimensionen berücksichtigen und gegebenenfalls neu justieren, um ein nachhaltiges und gerechtes Finanzsystem zu gewährleisten. Nicht zuletzt ist eine transparente und nachvollziehbare Finanzberichterstattung von Kreditgenossenschaften ein weiterer wichtiger Schritt, der in der Debatte oft gefordert wird. Während andere gemeinnützige Organisationen jährliche Berichte öffentlich zur Verfügung stellen müssen, bleiben viele Kreditgenossenschaften weitgehend von solchen Anforderungen verschont.