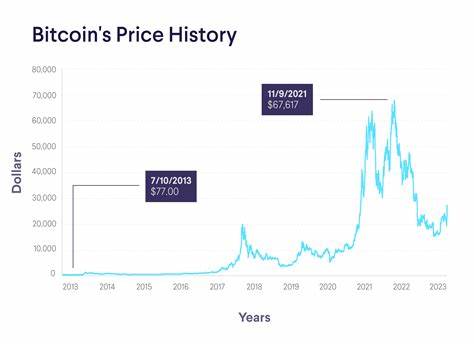Ostgalizien, einst ein vielfältiges multiethnisches Grenzgebiet, hat im Laufe des Zweiten Weltkriegs und seiner Nachwirkungen tiefgreifende ethnische Säuberungen und gewaltsame Konflikte erlebt, deren Folgen bis heute nachwirken. Die Region, die vor 1939 zu Polen gehörte und heute größtenteils in der Ukraine liegt, ist ein exemplarisches Beispiel für die komplexe Verstrickung verschiedener Bevölkerungsgruppen in massiven Gewalterfahrungen, die nicht nur individuelle Traumata auslösten, sondern auch die sozialen Strukturen ganzer Gemeinschaften zerstörten. Dieser Beitrag beleuchtet die mehrdimensionale Natur der Traumata, die Zivilisten in Ostgalizien zu Zeugen und Beteiligten dieser Gewalt machten, und untersucht sowohl psychologische als auch gesellschaftliche Auswirkungen. Dabei wird ersichtlich, dass das Leiden dieser sogenannten „verstrickten Zuschauer“ weit über das individuell Sichtbare hinausreicht und einen tiefgreifenden kollektiven Bruch markiert, der die Region bis heute prägt. Das Gebiet Ostgaliziens war bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs durch eine vielschichtige, ethnisch heterogene Bevölkerung charakterisiert.
Ukrainische Bewohner stellten hier die Mehrheit, während die jüdische Bevölkerung vor allem in den Städten etwa zehn Prozent ausmachte. Die polnische Minderheit, oft in privilegierter Position, betrug um die 25 Prozent, je nach Gebiet. Dieses Gefüge wurde im krassen Gegensatz zueinander von wiederkehrender und sich überlagernder Gewalt zerrissen – von der sowjetischen Repression, dem Holocaust über die ukrainischen nationalistischen Säuberungen an Polen bis hin zum sowjetisch-ukrainischen Partisanenkonflikt der Nachkriegszeit. Bereits unmittelbar nach der sowjetischen Annexion Galiziens im Jahr 1939 begannen massive Deportationen und Morde an der polnischen Bevölkerung sowie an der lokalen Elite. Die anarchischen Machtverhältnisse während der deutsche Besatzungszeit verstärkten diese Gewalt, wobei sich insbesondere der Holocaust in Ostgalizien durch die nahezu vollständige Vernichtung der jüdischen Gemeinden in der Region innerhalb von Monaten manifestierte.
Töten in der Nachbarschaft war Alltag – oft wurde die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung nicht nur von den deutschen Tätern durchgeführt, sondern durch lokale Helfer und Nachbarn aktiv unterstützt oder ermöglicht. Zeitgleich kam es zu ethnischen Säuberungen und Massakern an der polnischen Bevölkerung durch Gruppen ukrainischer Nationalisten, was wiederum durch polnische Vergeltungsakte beantwortet wurde. Die ununterbrochene Gewalt führte dazu, dass Bewohner verschiedener Ethnien fast ununterbrochen in wechselnden Rollen von Opfern, Zeug*innen, und Täter*innen gefangen waren. Die gewaltsamen Ereignisse in Ostgalizien führten zu einer traumatischen Erfahrung, die sich weit über die persönliche Ebene hinaus in die kollektiven Gedächtnisse der Gemeinschaften einprägte. Forschungen über sogenannte „Bystanders“ – also Menschen, die Zeugen von Gewalt werden, jedoch nicht unbedingt direkt Täter oder Opfer sind – zeigen, dass diejenigen, die in unmittelbarer Nähe der Gewalt lebten, von einem mehrschichtigen Trauma erfasst wurden.
Diese „verstrickten Zuschauer“ befanden sich nicht unbeteiligt am Rand, sondern waren durch die Kontinuität und Nähe der Gewalt immer wieder gezwungen, sich in wechselnden Rollen zurechtzufinden und dabei psychisch und sozial belastet zu werden. Das Konzept „implicated subjects“ von Michael Rothberg beschreibt diesen Zustand treffend: Menschen, die oft durch soziale und politische Umstände mit Gewalt verbunden waren, ohne selbst direkte Täter zu sein, litten ebenso unter den Folgeerscheinungen dieser Verstrickung. Die unmittelbare Nähe zu Szenen von Folter, Deportationen und Mord prägte das Leben in Ostgalizien bis in die intimsten Facetten. Bewohner sahen Nachbar*innen abtransportiert werden, wurden Zeugen von öffentlichen Misshandlungen, mussten oftmals bei der Beseitigung von Leichen oder der Mahnung von Gräbern helfen. Besonders Kinder erlebten diese Grausamkeiten als einschneidende Ereignisse, die nachhaltige psychische Auswirkungen hinterließen.
Manche verloren ihre bisherige Vorstellung von Sicherheit und Vertrauen in andere Menschen, machten Erfahrungen, die sich durch Angst, Schlafstörungen und psychosomatische Symptome ausdrückten. Die Gewalt führte zur Zerstörung der sozialen Bindungen in den Dörfern und Städten, die das Leben und Zusammenleben jahrzehntelang bestimmt hatten. Es entstand eine Atmosphäre der Unsicherheit, des Misstrauens und Schweigens, die die Gemeinschaften tief spaltete. Die Dimension der Gewalt in Ostgalizien war so stark, dass sie den Begriff des kollektiven oder kommunalen Traumas aufwirft. Kai Erikson definiert kollektives Trauma als eine Verletzung der grundlegenden sozialen Beziehungen und des Zusammenhalts, welche die Bindungen innerhalb einer Gemeinschaft dauerhaft beschädigt.
Die Massengewalt in Ostgalizien bedeutete nicht nur den Verlust von wichtigen Mitgliedern im sozialen und ökonomischen Gefüge – darunter Lehrer, Ärzte, Händler oder Nachbar*innen –, sondern auch die Zerstörung gemeinsamer Werte, Normen und Vertrauen. In der Folge zerfielen Gemeinschaftsstrukturen, soziale Ordnung wurde durch eine Welle von Gewalt und Gegengewalt ersetzt. Ebenfalls litt die soziale Moral, als immer mehr Menschen sich an der Gewalt beteiligten oder diese aktiv unterstützten, was das Netz der sozialen Beziehungen dauerhaft zerriss. Der erlebte Verlust erstreckte sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf materielle und symbolische Räume. Jüdische Friedhöfe wurden zerstört oder überbaut, massenhafte Gräber blieben unverzeichnet und wurden später oft mit öffentlichen Gebäuden oder Wohnhäusern überbaut.
Viele derjenigen, die nach dem Krieg in Ostgalizien blieben, mussten aktiv mit der Präsenz von Massengräbern und Überbleibseln der Gewalt leben. Sie bewohnten Häuser, die ehemaligen Opfern gehört hatten, und sahen sich gezwungen, das Erlebte zu verschweigen, wodurch sich ein kollektives Schweigen entwickelte, das das Trauma verstärkte. Auch die Nachkriegszeit war von Unsicherheit und neuer Gewalt geprägt, beispielsweise durch den fortdauernden Konflikt zwischen sowjetischen Behörden und der ukrainischen Partisanenbewegung. Viele Menschen waren danach gezwungen, in einer Umgebung zu leben, in der Täter und Opfer Seite an Seite existierten, ohne dass eine Verurteilung oder Verarbeitung der Vergangenheit stattfand. Diese „Gewalt am Alltag“ führte zu einem komplexen Schweigen, das sowohl aus Angst als auch aus sozialer Notwendigkeit resultierte, um das Überleben der Gemeinde zu sichern.
Psychologische Untersuchungen der unmittelbaren Nachkriegszeit in Polen zeigen, dass die Traumata, die sich aus den Kriegs- und Besetzungserfahrungen ergaben, bei vielen über körperliche und psychische Symptome sichtbar wurden. Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen und auch Alkoholismus waren weit verbreitet, nicht nur unter jenen, die direkte Gewalt erfahren hatten, sondern auch unter „nur“ Zeug*innen. Viele litten an anhaltenden Albträumen, die das Erlebte wieder aufleben ließen. Seit den 2010er Jahren wurden in mehreren Interviews mit Zeitzeugen aus Ostgalizien nachwirkende Belastungen dokumentiert, die zeigen, dass die Traumatisierung über Generationen weitergegeben wurde. Die Rolle des kollektiven Gedenkens ist eng mit der Bewältigung von Trauma verbunden.
In Ostgalizien wurde jedoch dieser Prozess durch politische Umstände stark erschwert. Sowohl in der Sowjetunion als auch in der Volksrepublik Polen war die Erinnerung an bestimmte Opfergruppen und Täterverhältnisse politisch unerwünscht oder gar tabuisiert. Die kommunistischen Regime verfolgten ein Narrativ, das viele Aspekte der ethnischen Säuberungen und der Gewalt unterdrückte oder verharmloste. Erst sehr spät und bis heute ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Themen möglich. Fehlende öffentliche Anerkennung und kollektive Verarbeitung haben nachfolgenden Generationen erschwerte Zugänge zum historischen Trauma bereitet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Trauma in Ostgalizien vielschichtig und komplex ist. Es umfasst individuelle psychologische Verletzungen, tiefe kollektive Verluste und die Herausbildung eines Kommunaltraumas, das den Zusammenhalt der Gemeinschaften zutiefst erschütterte. Das Phänomen der „verstrickten Zuschauer“ verdeutlicht, dass es in Zeiten massiver Gewalt kaum unbeteiligte Akteure gab. Menschen lebten in einem Zustand permanenter Verwundbarkeit und sozialer Ambivalenz, geprägt von Nähe zu Todeserfahrungen, von Rollenwechseln zwischen Opfer und Täter und von einem anhaltenden Schweigen. Der Umgang mit diesen Traumata erfordert eine vielschichtige Herangehensweise – von psychologischer Nachsorge über historisch-kritische Aufarbeitung bis zu gesellschaftlichen Erinnerungskulturen.
Ostgalizien bleibt ein mahnendes Beispiel dafür, wie ethnische Gewalt und Säuberungen nicht nur Leben zerstören, sondern auch die psychische und soziale Substanz ganzer Regionen über Jahrzehnte belastet und prägt. Das Verständnis dieser Prozesse ist nicht nur für die historische Forschung, sondern auch für Versöhnungs- und Friedensbemühungen in vielfältigen Gesellschaften relevant, die sich mit ähnlichen Erfahrungen auseinandersetzen.