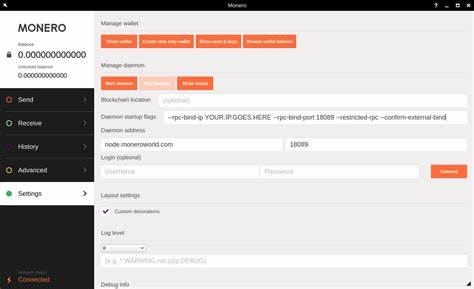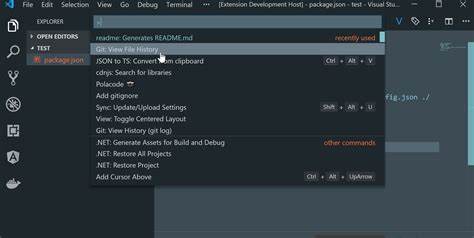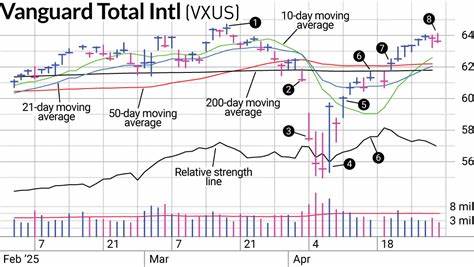Die Idee einer kabellosen USB-Verbindung klang vor zwanzig Jahren revolutionär: Geräte sollten ohne physische Kabel kommunizieren können, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit einzubüßen. Wireless USB schien die nächste logische Evolution eines seit langem etablierten Standards zu sein. Doch trotz zahlreicher Hoffnungen und dem enormen Potenzial blieb die Technologie weit hinter den Erwartungen zurück und verschwand faktisch vom Markt. Was genau ist passiert? Warum konnte Wireless USB nicht den Markt für sich gewinnen, obwohl es mit starken Partnern und technischer Raffinesse ins Rennen ging? Der Ursprung der kabellosen USB-Technologie reicht zurück in die frühen 2000er Jahre, als drahtlose Verbindungen im Consumer-Bereich massiv an Bedeutung gewannen. WLAN mit dem 802.
11-Standard eroberte gerade Haushalte und Unternehmen, Bluetooth entwickelte sich zu einer weitverbreiteten Lösung für kurze Distanzen, allerdings mit limitierter Datenrate. Wireless USB wollte an dieser Stelle mit Ultra Wideband (UWB) ansetzen. UWB liefert durch extrem breite Frequenzbereiche und niedrige Übertragungsleistungen technisch gesehen eine Basis für schnelle, aber energieeffiziente kurzreichweitige Verbindungen. UWB basiert auf der Impulsradartechnik, wobei sehr kurze und schwache Funksignale über ein breites Frequenzspektrum gesendet werden. Die Übertragung erfolgt meist im Bereich von 3,1 bis 10,6 GHz, ermöglicht hohe Bandbreiten bei geringer Reichweite und minimiert Störeinflüsse auf andere Funktechnologien.
Da UWB-Signale unterhalb der wahrnehmbaren Geräuschschwelle anderer Geräte operieren, sollten Störungen auf das Minimum reduziert werden. Bereits diese Konzeptidee versprach kabellose Verbindungen mit Datenraten, die Bluetooth nie erreichen konnte und die WLAN zu jener Zeit noch nicht zuverlässig bot. Doch die technische Realität zeigte sich komplexer. Im Zuge der Standardisierungsarbeit des IEEE 802.15.
3a gerieten zwei konkurrierende UWB-Technologien in einen erbitterten Wettstreit: Direct Sequence Ultra Wideband (DS-UWB), das auf einer Art Code-Multiplex-Verfahren basierte, und Multiband Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (MB-OFDM), das Frequenzsprungverfahren mit vielen Subträgern verwendete. Diese Inkompatibilität führte dazu, dass sich Industrieunternehmen auf unterschiedliche Lager verteilten, Chipdesigns und Patente blockierten sich gegenseitig, und der Prozess führte zu Verzögerungen und Verwirrung in der Branche. Intel unterstützte vehement MB-OFDM, während Unternehmen wie Motorola und später Freescale DS-UWB favorisierten. Die markante Konkurrenz führte nicht nur zur Spaltung der UWB-Landschaft, sondern verströmte auch Signalverwirrung und Unsicherheit bei OEMs und Endkunden. Gerade in der Technologiebranche, wo Standardisierung und Interoperabilität entscheidende Faktoren sind, wirkte dieses Getrenntsein wie ein K.
O.-Schlag. Parallel zu diesem internen Streit nahm Bluetooth mit Version 2.0 und später 3.0 eine bedeutende Rolle ein, indem es für alltägliche Anwendungen genügende Datenraten lieferte und seinen Ökosystemvorteil weiter ausbaute.
WLAN wurde zudem zunehmend schneller und günstiger, was manche Hürden von Wireless USB, vor allem in Reichweite und Kompatibilität, noch deutlicher machte. Zudem waren WLAN und Bluetooth weit verbreitet und etabliert, während Wireless USB mit Dongles oder eigenen Adaptern wartete, die häufig externe Anschlüsse belegten. Die ersten Wireless USB-Produkte wie Belkins Cable-Free USB und Intels Certified Wireless USB waren zwar technisch innovativ, brachten jedoch diverse praktische Probleme mit sich. Reichweite und tatsächliche Bandbreiten entsprachen selten den hohen Erwartungen. Während spezifizierte Werte von USB 2.
0 mit bis zu 480 Mbit/s genannt wurden, lagen reale Durchsatzraten oft ein Vielfaches darunter und fielen bei Entfernung oder Hindernissen drastisch ab. Auch die Komplexität der Integration wirkte sich negativ aus. Viele Wireless USB-Geräte verlangten zusätzliche Dongles für die Verbindung zum Computer – was kaum als echte Kabellosigkeit empfunden wurde, da ein weiteres Gerät an einen ohnehin oft knappen USB-Port angeschlossen werden musste. Die Installation erforderte teils spezielle Treiber, die nicht immer für alle Betriebssysteme oder Systemversionen verfügbar oder stabil waren. Auch das Pairing und die Sicherheit gestalteten sich in der Praxis als hinderlich.
Zwar wurde AES-128-Verschlüsselung verwendet, doch die Verfahren für die Authentifizierung waren oft umständlich, was Nutzer abschreckte. Ein weiterer wichtiger Faktor war die rasante Entwicklung der Konkurrenztechnologien. Bluetooth, ursprünglich für einfache Peripheriegeräte konzipiert, entwickelte sich weiter und schaffte zunehmend höhere Datenraten mit Bluetooth 3.0+HS und späteren Versionen. Zwar setzten diese immer noch auf WLAN als Übertragungsmedium für hohe Bandbreiten, konnten aber nahtlos zwischen Bluetooth-Signal und WLAN-Datenverbindung wechseln – was von den Endanwendern als einfacher und praktisch empfunden wurde.
WLAN selbst wurde dank neuer Standards wie 802.11n und später ac schneller, energiesparender und günstiger. Auch Hersteller blieben von Wireless USB eher fern. Die geringe Verbreitung und die erforderlichen Zusatzhardware führten dazu, dass kaum native Geräte mit Wireless USB-Unterstützung auf den Markt gebracht wurden. Selbst Notebook-Hersteller boten Wireless USB oft nur als zusätzliche Option an, nicht als serienmäßigen Standard.
Dies minderte die Aussicht auf eine kritische Masse an kompatiblen Geräten erheblich. Parallel dazu geriet die UWB-Allianz, zunächst WiMedia Alliance, zunehmend unter Druck. Die Standards wurden notgedrungen außerhalb des IEEE beim Ecma International veröffentlicht (ECMA-368), was die Adoption zusätzlich behinderte. Die technischen Streitereien, mangelnde Marktreaktion und sinkende Chancen auf Durchbruch führten zur Auflösung der WiMedia Alliance 2009. Die meisten Partner zogen sich zurück, auch weil der Nutzen von UWB für Hochgeschwindigkeitsdatentransfers durch das Voranschreiten von Bluetooth und WLAN schmälerte.
Andere Unternehmen versuchten alternative Ansätze. So setzte Gefen mit seinem Wireless USB Extender auf herkömmliches 802.11g Wi-Fi statt UWB. Obwohl diese Geräte die Einschränkungen von UWB umgingen, litten sie durch WLAN-typische Probleme wie begrenzte Bandbreite von 54 Mbit/s, Sicherheitsrisiken durch schwache Verschlüsselung und eigene Stromversorgungsanforderungen. Die Lösungen waren teuer, klobig und blieben Nischenprodukte.
Damit verlor Wireless USB letztlich den Wettkampf gegen bestehende Technologieoptionen durch mangelnde technische Reife, Unübersichtlichkeit der Standardisierung und fehlende Unterstützung durch große Marktteilnehmer. Zudem schafften es weder die ersten Produkte, die versprochenen Vorteile vollständig zu realisieren, noch konnten sie sich wirtschaftlich rentabel positionieren. Die Vorteile einer drahtlosen USB-Verbindung im persönlichen Bereich wurden durch die „All-in-one“-Lösungen moderner WLAN- und Bluetooth-Technologien überflügelt. Heute ist UWB durchaus kein Relikt, aber seine Hauptanwendung findet sich in präziser Ortung und Sicherheitsanwendungen, wie zum Beispiel in Apples U1-Chip für AirTags und iPhones. Für breitbandige, kabelersetzende Datenübertragungen wie USB bleibt UWB dagegen ungenutzt.