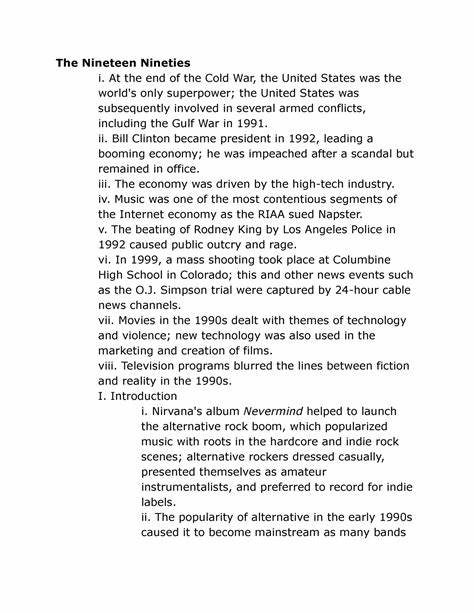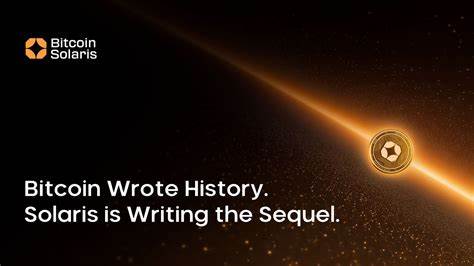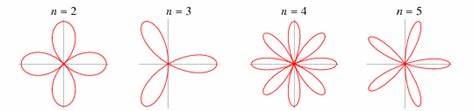Die neunziger Jahre sind ein Jahrzehnt, das heute nostalgisch betrachtet wird, jedoch war es damals eine Zeit des Umbruchs, der Erwartungen und der kulturellen Neuausrichtung. In einem außergewöhnlichen literarischen Werk nimmt uns der Zauberkünstler Teller, bekannt als die ruhigere Hälfte des Duos Penn & Teller, mit auf eine faszinierende Zeitreise. Dabei verbindet er die Magie der Illusion mit der Magie der Literatur und schafft ein einzigartiges Erlebnis, das weit über reine Unterhaltung hinausgeht. In seinem Essay „A Memory of the Nineteen-Nineties“ erzählt Teller die dramatische Geschichte des fiktiven Dichters Enoch Soames, dessen Schicksal sich im London der Vergangenheit und der Zukunft gleichermaßen entfaltet. Das Setting dieses literarischen Rückblicks ist der große Lesesaal der British Library in London, ehemals der Round Reading Room des British Museum, welcher den Geist vergangener Zeiten noch immer atmet.
Hier, unter der beeindruckenden Kuppel und inmitten unzähliger Bücher und Kataloge, wird eine einmalige Begebenheit beschrieben: Am 3. Juni 1997 um exakt 14:10 Uhr sollte sich eine bemerkenswerte Gestalt zeigen, der Dichter Enoch Soames, der angeblich vor 100 Jahren, am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit, von einem geheimnisvollen Fremden – dem Teufel – aus seiner undankbaren Zeit ins späte 20. Jahrhundert gebracht wurde, um die Bedeutung seiner Werke zu überprüfen. Die Geschichte basiert auf Max Beerbohms Kurzgeschichte „Enoch Soames: A Memory of the Eighteen-Nineties“, die Teller in seiner Schulzeit gelehrt wurde und die ihn über mehrere Jahrzehnte beschäftigt hat. Beerbohm beschreibt Soames als einen unauffälligen, eher traurigen Dichter, dessen Werke kaum Beachtung fanden, obwohl er sich selbst für einen großen Literaten hielt.
Die Ironie seines Schicksals liegt darin, dass Soames bereit ist, seine Seele für die Anerkennung in der Zukunft zu verkaufen – doch die moderne Welt kennt ihn nur als eine fiktive Figur, geschaffen von Beerbohm selbst. Teller verwebt in seinem Bericht geschickt die reale Suche und die gesammelten Beobachtungen jener wenigen Menschen, die am 3. Juni 1997 im British Museum auf das Erscheinen Soames warteten. Menschen aus unterschiedlichen Gegenden und Berufen kamen zusammen – Literaturkritiker, Studenten, Zauberkünstler und Schriftsteller – alle angezogen vom Gedanken, eine direkte Verbindung zur Vergangenheit zu erleben. Das Ambiente des Lesesaals, die Atmosphäre der Erwartung und die Anwesenheit von Soames selbst – ob nun tatsächlich ein realistisches Schauspiel, eine Inszenierung oder gar eine Erscheinung – erzeugen eine elektrische Spannung und berühren tiefgehende Fragen über Erinnerungen, Identität und die Bedeutung von Kunst und Ruhm.
Das Auftreten von Soames im grauen Inverness-Mantel und dem schwarzen Hut wirkt wie eine lebendige Illusion. Seine Suche im Katalog nach seinem Namen symbolisiert die zeitlose Sehnsucht nach Anerkennung und die tragische Erkenntnis der Vergänglichkeit. Trotz seines unerschütterlichen Glaubens an die eigene Bedeutung findet Soames nur einen einzigen Verweis, der besagt, dass er eine erfundene Gestalt sei. Diese Erkenntnis verwandelt die literarische Fiktion in eine existenzielle Wahrheit: Nicht jeder, der sich bedeutend fühlt, hinterlässt tatsächlich einen bleibenden Einfluss. Die Beschreibung des Lesesaals mit seinen historischen Arbeitsplätzen berühmter Persönlichkeiten wie Yeats, Shaw und Karl Marx verstärkt zusätzlich die Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart.
Teller lenkt damit die Aufmerksamkeit auf das Fortwirken von Ideen und auf die Art und Weise, wie Kultur und Erinnerungen über Generationen hinweg weitergegeben oder vergessen werden. Diese Szenerie spiegelt die menschliche Sehnsucht wider, im Strom der Zeit nicht verloren zu gehen und eine Spur zu hinterlassen. Der Autor selbst ist Teil des Geschehens und schildert eindrucksvoll, wie die Uhr im Lesesaal ohne Sekundenzeiger stoisch den Zeiger Richtung zehn vor zwei schiebt, während sich die Menge voller Erwartung versammelt. Die minutiöse Vorbereitung und die lange Vorfreude – Teller wartete 34,5 Jahre darauf, an diesem Ort zu sein und das Ereignis zu erleben – verleihen der Erzählung eine fast mystische Aura. Die Geschichte berührt auch subtil die Dynamik von Fiktion und Realität.
Soames lebt in den Vorstellungen der Menschen und zugleich im Schatten der von Beerbohm geschaffenen Welt. Dieses Spannungsfeld lädt dazu ein, über die Bedeutung von Erzählungen, die Kraft der Literatur und die Grenzen zwischen Realität und Imagination nachzudenken. Es stellt sich die Frage, wie weit die Wirkung eines Textes über die Zeit reicht und wie Persönlichkeit und Werk unvermeidbar miteinander verwoben sind. Teller greift außerdem auf persönliche Erinnerungen zurück, indem er von seinem Englischlehrer D. G.
Rosenbaum, auch genannt „Rosey“, berichtet, der ihm die Geschichte von Enoch Soames näherbrachte. Rosenbaum wird als charismatische und geheimnisvolle Figur mit einer Vorliebe für Psychoanalyse, Literatur und einen Hauch Magie beschrieben – Eigenschaften, die auch im Schreiben und Erzählen eine Rolle spielen. Seine späte Ruhestätte und die Erinnerung an sein Lachen verleihen dem Text eine feierliche Note und erinnern daran, wie prägend Lehrer und Mentoren auf unser Leben und unsere Wahrnehmung von Kunst und Geschichte wirken können. Das Aufeinandertreffen von zahlreichem Publikum im Lesesaal am besagten Tag wird mit großen Emotionen beschrieben. Die Mischung aus Skepsis, Staunen und leiser Ehrfurcht erzeugt eine Atmosphäre, in der die Grenzen zwischen Zeitaltern ausgelöscht scheinen.
Menschen aus der Gegenwart begegnen einer Erscheinung aus der Vergangenheit, die den Funken der Hoffnung und die Tragik des Vergessens zugleich verkörpert. Die britische Institution des British Museum und später der British Library bildet neben der erzählten Geschichte gleichzeitig ein Sinnbild für Kontinuität, Wissenskultur und den Wandel der Zeiten. Der geplante Umzug der Bestände in moderne Einrichtungen unterstreicht den Abschied von alten Formen und das Beibehalten der Erinnerung in moderner Hülle – eben wie Soames‘ Geschichte selbst, die zwischen Historie und Fiktion pendelt. Teller gelingt es mit seiner Erzählung, das Thema des Vergessens und der Sehnsucht nach Unsterblichkeit eindrucksvoll zu veranschaulichen. Auch wenn Enoch Soames als Figur den Anspruch hatte, in die Literaturgeschichte einzugehen, blieb sein Ruhm aus.
Dennoch lebt seine Geschichte weiter und wird heute diskutiert, was beweist, dass Unsterblichkeit manchmal dort liegt, wo man sie am wenigsten erwartet – im Mythos, in der Kunst und in der Erinnerung anderer. Das Werk bietet eine tiefgründige Betrachtung darüber, wie wir uns als Menschen in der Zeit verorten, welche Bedeutung wir Kunst und Literatur zuschreiben und wie Geschichten unser Verständnis von Vergangenheit und Zukunft formen können. Die Verbindung von Realität und Fiktion, die in diesem Bericht erlebbar wird, spiegelt die Magie wider, die Teller mit seiner Kunst und seiner Persönlichkeit in die Welt einbringt. Ein Rückblick auf die neunziger Jahre durch die Linse von Teller und Max Beerbohms literarischer Figur zeigt damit mehr als nur nostalgische Erinnerungen. Es geht um das menschliche Streben nach Anerkennung, die Macht der Geschichten und die Art und Weise, wie Kunst tiefgreifende Fragen über Zeit, Identität und Bedeutung stellen kann.
Die Erzählung von Enoch Soames bleibt dadurch ein zeitloses literarisches Denkmal, das den Leser zum Nachdenken anregt und ihn in das faszinierende Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eintauchen lässt.