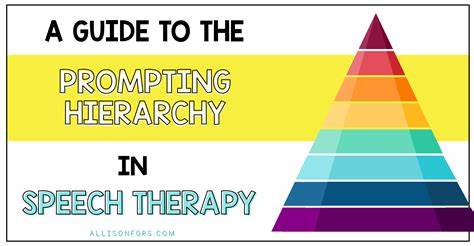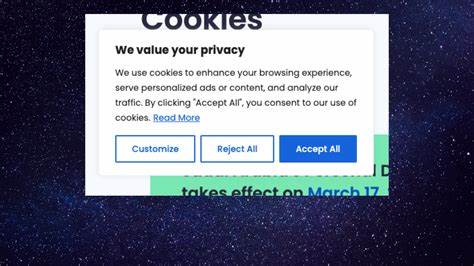Künstliche Intelligenz und insbesondere große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Sie bieten ein beeindruckendes Potenzial, komplexe Aufgaben zu automatisieren, kreative Prozesse zu unterstützen und tägliche Routinetätigkeiten zu vereinfachen. Trotzdem erleben viele Nutzer eine gewisse Frustration, wenn die Antworten der Modelle nicht den Erwartungen entsprechen oder ungenau sind. Genau hier spielt das Konzept des Promptings eine entscheidende Rolle. Prompting bezeichnet die Kunst und Technik, die richtige Eingabeaufforderung so zu formulieren, dass das Modell optimale und sinnvolle Resultate liefert.
Dieser Leitfaden beleuchtet die Grundlagen, Strategien und Feinheiten des Promptings und zeigt auf, wie man die Leistung von KI-Systemen nachhaltig verbessert. Zu Beginn ist es wichtig zu verstehen, dass das Ergebnis eines Sprachmodells stark von der Formulierung des Prompts abhängt. Anders als bei traditionellen Algorithmen, bei denen dieselbe Eingabe stets dieselbe Ausgabe erzeugt, sind LLMs flexibel und kontextabhängig. Das heißt, eine leicht veränderte Frage kann völlig unterschiedliche Antworten hervorrufen. Deshalb gleicht Prompting mehr einer Kunst, die ein feines Gespür erfordert, als einem starren Verfahren.
Ein bewährter Ansatz ist, das Modell in eine bestimmte Rolle zu versetzen. Wenn man beispielsweise möchte, dass die KI als erfahrener Softwareentwickler agiert, sollte der Prompt dies explizit so ausdrücken. Durch die Rollenvorgabe wird das Modell auf einen Kontext eingeschworen, der seine Antworten in eine sinnvolle Richtung lenkt und fachlich fundierte Resultate begünstigt. Die Spezifizität eines Prompts ist ein weiterer fundamentaler Faktor. Allgemeine Aufforderungen wie "Fasse zusammen" oder "Schreibe um" bieten dem Modell zu wenig Orientierung.
Eine genauere Beschreibung, beispielsweise "Fasse den Text in drei prägnanten Stichpunkten zusammen, die die größten Herausforderungen für den Kunden hervorheben", führt fast immer zu besseren und gezielteren Ergebnissen. Hierbei ist es ratsam, auch das gewünschte Format der Antwort klar zu definieren. Sprachmodelle sind exzellent in der Erzeugung strukturierter Ausgaben wie JSON oder XML, was vor allem bei der Weiterverarbeitung von Vorteil ist. Ein oft unterschätztes Werkzeug ist die Verwendung von Beispielen im Prompt, besonders wenn komplexe oder ungewöhnliche Antworten erwartet werden. Indem man dem Modell Ein- und Ausgabepaare vorlegt, kann man dessen Aufmerksamkeit gezielt auf das gewünschte Muster lenken und somit eine höhere Qualität sicherstellen.
Experimentieren und Optimieren gehören ebenfalls zum Handwerk des Promptings. Es kann ungemein hilfreich sein, zunächst ein klares Ziel der gewünschten Ausgabe zu formulieren und für unterschiedliche Eingabedaten passende Beispielantworten zu entwerfen. Anschließend sollte man verschiedene Varianten des Prompts testen, um mit einem iterativen Prozess die bestmögliche Formulierung zu finden. Im technischen Aufbau von Prompts kann man verschiedene Schichten unterscheiden, die jeweils eine andere Funktion erfüllen. Die System-Prompt-Ebene legt das grundlegende Verhalten des Modells fest, indem sie etwa bestimmt, dass alle Antworten im Stil eines professionellen Lebenslaufes zu verfassen sind.
Weiter darunter findet sich die Developer-Prompt-Ebene, die Geschäftslogik und Kontextdaten einbinden kann und für Konsistenz sorgt. Auf der untersten Ebene steht der User-Prompt, der individuelle Anpassungen ermöglicht, die sich aber immer im Rahmen der höheren Ebenen bewegen. Für Anwendungen mit Endnutzern ist es sinnvoll, die komplexe Promptlogik vor allem auf den System- und Entwickler-Layern zu verankern, damit die eigentlichen Nutzer einfache und intuitive Eingaben machen können, die trotzdem zu hochwertigen Ergebnissen führen. Die Auswahl des richtigen Modells für eine bestimmte Aufgabe ist ebenfalls entscheidend. Unterschiedliche LLMs haben verschiedene Stärken, etwa in Bezug auf die Größe ihres Kontextfensters oder ihre Fähigkeit zu logischem Denken und schrittweisem Planen.
Für umfangreiche Kontexte bieten sich größere Modelle mit entsprechend großem Speicher an, während für klar strukturierte, sich wiederholende Aufgaben auch kleinere, schneller arbeitende Modelle ausreichend sein können. Modelle, die speziell für Denkprozesse optimiert sind, ermöglichen komplexe Schlussfolgerungen und Anpassungen, wohingegen einfachere Modelle für klar definierte Musterlösungen effizient sind. Wichtig ist auch, das Trainingsmaterial des jeweiligen Modells zu berücksichtigen, um das Prompting optimal anzupassen. Ein praktischer Tipp, der oft übersehen wird, ist, die KI selbst beim Erstellen des Prompts zu unterstützen. Das Modell kann Rückfragen formulieren, um das Verständnis der Aufgabe zu vertiefen, und basierend darauf einen verfeinerten Prompt generieren.