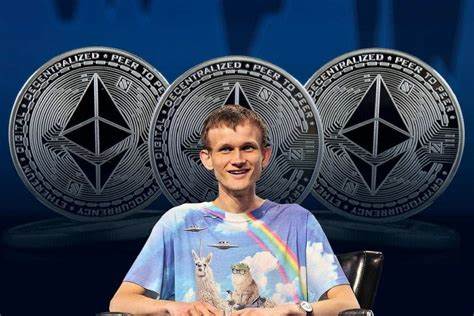Im heißesten Gebiet Brasiliens, in der östlichen Region des Bundesstaates Minas Gerais, kämpfen die Maxakali, eine indigene Gemeinschaft, mit den verheerenden Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung. Ihre Heimat, einst bedeckt von der dichten und artenreichen Atlantischen Regenwald-Region, ist heute geprägt von trockenen Ebenen, invasiven Grassorten und häufigen Bränden. Doch trotz dieser Herausforderungen erfinden sich die Maxakali nicht nur neu, sie verbinden mit einem innovativen und zugleich traditionellen Ansatz ihre alte Kultur mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Das Herzstück ihrer Widerstandsfähigkeit ist das Projekt Hāmhi Terra Viva, eine von den Maxakali geleitete Agroforstinitiative, die seit 2023 erfolgreich Wälder wiederaufforstet und landwirtschaftliche Flächen mit lokalen, bodenschonenden Pflanzen kultiviert. Was dieses Projekt so besonders macht, ist die Verknüpfung von Ökologie und Kultur.
In ihren Bereichen wachsen Bananen, Maniok und Guaven zwischen traditionellen Anbauformen und neugepflanzten Bäumen – eine grüne Oase inmitten der von Feuer gezeichneten Landschaft. Die einst mächtigen Atlantischen Wälder boten nicht nur Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen, sondern regulierten durch ihre dichte Baumdecke auch das Klima vor Ort maßgeblich. Leider wurde mehr als 85 Prozent der Wälder durch jahrzehntelange Abholzung, Brandrodungen und landwirtschaftliche Expansion zerstört. Vor allem die Invasion von Guinea-Gras, einer in Brasilien eingeführten afrikanischen Grassorte, verschärft die Feuergefahr. Das Gras gilt als extrem leicht entflammbar, weshalb es von den Maxakali auch als „Kerosin“ bezeichnet wird.
Die Brände, die sich durch diese Vegetation rasch ausbreiten, beschädigen weitere Flächen und verstärken den Temperaturanstieg in der Region. Die Maxakali-Gemeinschaft leidet stark unter den Folgen. Ihr Zugang zu frischem Wasser schwindet, wie das Austrocknen des Flusses nahe dem Dorf Pradinho eindrücklich zeigt. Historisch betrachtet war die Region durch ein Netzwerk von Flüssen, üppigen Wäldern und vielfältigen Lebensräumen geprägt, die Nahrung, Heilpflanzen und Baumaterial lieferten. Heute existiert nur noch ein Bruchteil dieser Ökosysteme.
Die fortschreitende Klimaerwärmung, befeuert durch Entwaldung und menschliche Eingriffe, positioniert die Region de facto im Epizentrum der Klimakrise Brasiliens. Inmitten dieser Herausforderungen bleibt die kulturelle Identität der Maxakali jedoch ungebrochen. Musik und traditionelle Gesänge nehmen eine zentrale Rolle im Alltag und auch in der Umweltarbeit ein. Anders als in westlichen Kulturen, in denen Lieder oft komponiert oder neu erstellt werden, besitzen die Maxakali eine Vielzahl von überlieferten Liedern, die fest mit der Natur und ihrem spirituellen Weltbild verbunden sind. Diese Gesänge, mehrere Hundert Stunden lang, sind detailreiche ökologische Enzyklopädien in musikalischer Form.
Sie beinhalten nicht nur Namen von Pflanzen und Tieren, sondern auch Informationen über deren Verhalten und ökologische Beziehungen – ein wertvoller Schatz an traditionellem Wissen. Bei der Pflanzung der Bäume und Pflege der Setzlinge in den Baumgärten wird dieses Wissen durch gemeinsames Singen wachgehalten. Der Gesang ist nicht nur künstlerischer Ausdruck, sondern wird als spirituelle Hilfe und als lebendiger Gedächtnisspeicher genutzt. Er unterstützt die Gemeinschaft beim Erinnern an die verlorenen Pflanzenarten und verschaffte ihnen Zugang zu praktischen Anleitungen für nachhaltiges Gärtnern und nachhaltige Nutzung der Ressourcen. Die Initiative Hāmhi Terra Viva verbindet so auf einzigartige Weise indigene Kultur mit Umweltschutz.
Über 200 Hektar wurden seit Beginn des Projekts mit einheimischen Bäumen und Nutzpflanzen bepflanzt. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Obstbäumen, die Nahrung sichern und Feuerresistenz bieten, sowie Baumarten, die helfen, das Mikroklima lokal zu stabilisieren und die Bodenqualität zu verbessern. Durch die bewusste Wahl verschiedener Pflanzenarten werden natürliche Barrieren gegen Waldbrände geschaffen. Parallel dazu organisieren sich die Maxakali gemeinschaftlich zum Schutz vor Bränden. Eine eigene Feuerwehr wurde gegründet, und es werden traditionelle Techniken genutzt, um Feuer zu kontrollieren oder einzudämmen.
Damit grenzt sich die Gemeinschaft von der Politik und den wirtschaftlichen Interessen ab, die oftmals auf kurzfristige Ausbeutung der Natur setzen. Die Maxakali wollen als Hüter ihrer Heimat langfristige, nachhaltige Strategien etablieren. Die brasilianische Geschichte der Region erklärt mit, warum die Zerstörung so gravierend ist. Die Ära der Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985 beschleunigte die Abholzungen im Namen der Modernisierung und wirtschaftlichen Entwicklung drastisch. Straßen wurden durch die Wälder gebohrt, und große Flächen wurden für Viehzucht und Landwirtschaft umgewandelt.
Diese Entwicklungen führten zum Verlust großer Teile des Atlantischen Regenwaldes und hatten direkte Auswirkungen auf das lokale Klima und die Lebensgrundlagen indigener Völker. Der Klimawandel verstärkt nun diese strukturellen Probleme. Die Region verzeichnete 2023 Temperaturrekorde von über 44 Grad Celsius, was ernste Konsequenzen für Menschen, Tiere und Pflanzen hat. Die Kombination aus Hitze, knappen Niederschlägen und invasiven Grasarten führt zu einer dramatischen Zunahme von Waldbränden. Diese wiederum vernichten nicht nur die Natur vor Ort, sondern verändern die Atmosphäre und das lokale Wetter zusätzlich.
Angesichts dieser komplexen Herausforderungen ist die Widerstandsfähigkeit der Maxakali besonders bemerkenswert. Sie stellen sich nicht nur mit praktischen Maßnahmen wie Pflanzungen und Brandschutz der Zukunft, sondern auch mit einer tief verwurzelten spirituellen Verbindung zur Natur. Die Lieder sind ein Aufruf an die Ahnen, die sie im Kampf gegen Umweltzerstörung unterstützt sollen. Damit entsteht ein ganzheitliches Konzept, das ökologische, soziale und kulturelle Aspekte vereint. Die internationale Bedeutung der Maxakali-Initiative wächst.
Ihr Ansatz zeigt, wie indigene Traditionen und Wissen wertvolle Impulse für den Umweltschutz bieten können. Statt lediglich als Opfer der Klimakrise zu gelten, treten die Maxakali als aktive Akteure in Erscheinung, die mit nachhaltigen Methoden versuchen, ihre Welt wiederaufzubauen. Ihr Erfolg kann als ein Modell dienen, das in anderen Regionen mit ähnlichen Problemen adaptiert werden könnte. Dabei bleibt die Integration von Kultur und Ökologie ein zentraler Faktor. Die Lieder und Traditionen bewahren Wissen, das auf generationsübergreifender Beobachtung und Verbundenheit mit der Umwelt beruht.
Diese Art von eingebettetem Wissen ist weltweit einzigartig und wertvoll für die Forschung und den Naturschutz. Die Herausforderung der Maxakali ist jedoch noch lange nicht überwunden. Der fortwährende Druck von wirtschaftlichen Interessen, der Klimawandel und der Verlust von Biodiversität gefährden weiterhin ihre Existenzen. Doch ihre Strategie gibt Hoffnung, dass nachhaltige, kulturell verankerte Ansätze eine wichtige Rolle im Kampf für den Planeten spielen. Mit der Kombination aus Gesang und Saat geben die Maxakali ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Traditionen und moderne Umweltpraktiken Hand in Hand gehen können, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern.
Die Geschichte der Maxakali ist daher nicht nur eine lokale Erzählung über den Kampf gegen den Klimawandel, sondern ein globales Symbol für Widerstand, Anpassung und die Kraft von kultureller Identität in der Bewahrung unserer natürlichen Welt.